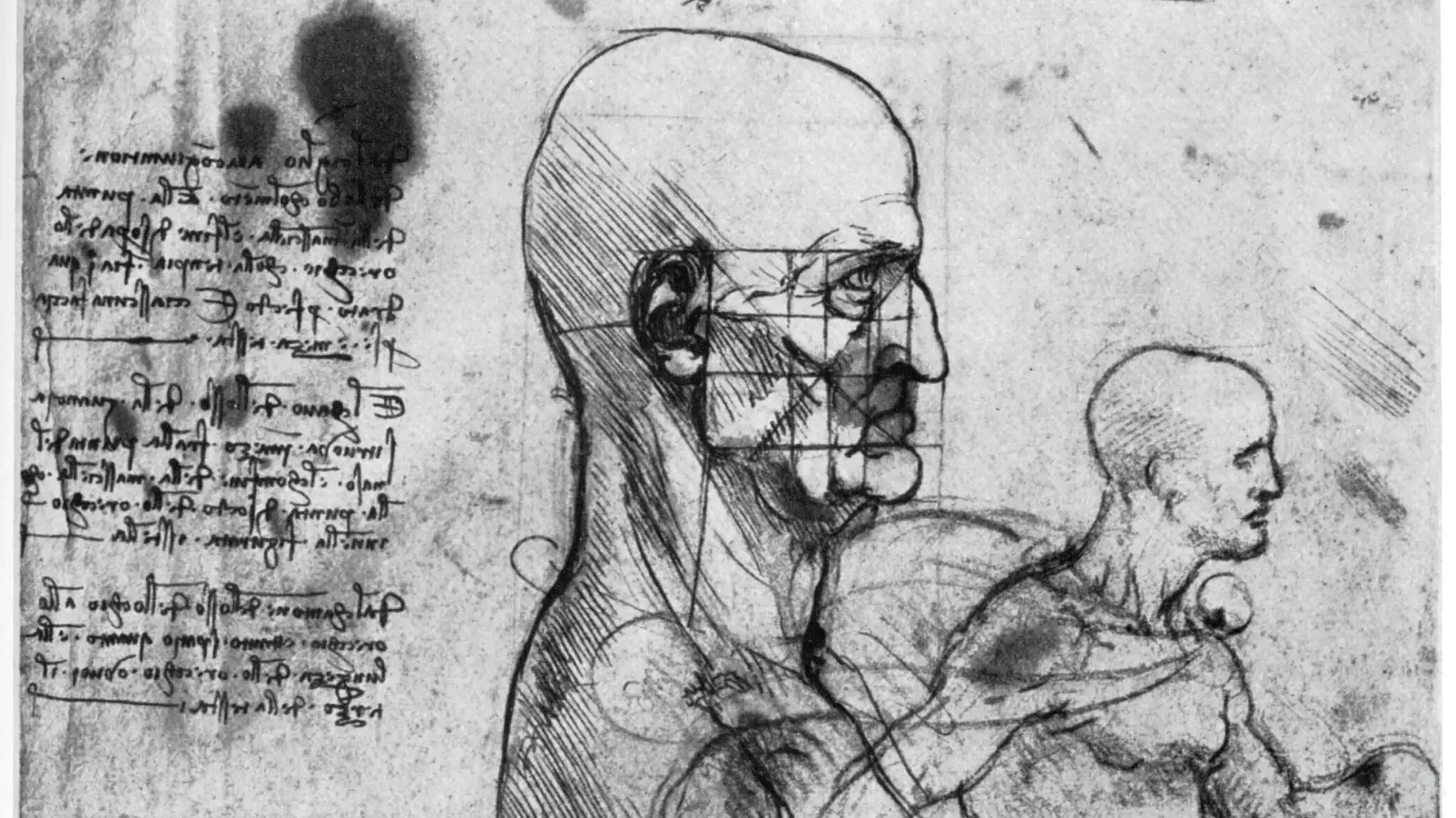Das Interview hier zum Nachlesen:
Herr Bischof Oster, das christliche Menschenbild reibt sich derzeit mit dem gesellschaftlichen Mainstream, vor allem, wenn es um das Recht auf Leben am Anfang und am Ende geht. Wie können die Christen in einer Gesellschaft, die meint, ohne Gott gut leben zu können, glaubwürdig für das Leben eintreten?
Zunächst bin ich überzeugt, dass sich wesentliche Positionen zum Lebensschutz – etwa gegen Abtreibungen – auch rational begründen lassen, ohne dafür einen religiösen Glauben in Anspruch nehmen zu müssen. Für uns Christen ist dennoch die Glaubensüberzeugung die wesentliche Dimension: Wir leiten unsere Würde aus der biblisch grundgelegten Gottebenbildlichkeit ab – und sind von dort her besonders verpflichtet, menschliches Leben zu schützen, von der Empfängnis bis zum letzten Atemzug.
Und wenn ich nun z.B. auf Eltern mit kleinen Kindern schaue: Selbst wenn jemand noch so ungläubig daher kommt. Ein normaler Mensch wird seinem kleinen Kind die Welt immer als wahr, gut und schön präsentieren. Nur beispielhaft: „Mmh, schmeckt das gut“. „Schau mal, wie lieb der Wauwau ist.“, „Siehst Du die schönen Blumen?“ usw. Und er wird versuchen, die Lüge, den Schmerz, die Bedrohung so lange wie möglich vom Kind wegzuhalten. Das heißt aber doch: Wenn so ein „normaler“, vielleicht ungläubiger Mensch dem Kind das „Urvertrauen“ bewahren oder stärken will, spricht er wie von selbst von einer ursprünglich guten und schönen und verlässlichen Welt. Und das Übel kommt erst sekundär hinzu!
Und wenn er es damit ernst meint, dann sagt er damit, dass die Welt ursprünglich eben kein grausamer Zufall ist und dass auch das Kind selbst keine grausame Willkürerscheinung im Universum ist, sondern eben, dass es Sinn gibt und Schönheit und Güte. Er erzählt seinem Kind gewissermaßen eine Paradiesesgeschichte. Und er braucht sie sogar für eine gute Entwicklung des Kindes. Im Grund kommt er also nicht ohne Gott aus. Das wäre zumindest eine Möglichkeit zu argumentieren. Am glaubwürdigsten über die bloßen Argumente hinaus sind freilich immer die Liebe und die Demut.
Ist die Debatte um das Recht auf Leben aus Ihrer Sicht ideologisch untermauert? Oder ist es schlichte Gleichgültigkeit oder Dekadenz der Spaßgesellschaft?
Ich weiß gar nicht, ob das die richtigen Alternativen sind. Es könnte ja auch eine Ideologie sein, die sich die Spaßgesellschaft gebildet hat, um weiterhin Spaß haben zu können und keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Und tatsächlich: Wir neigen ja immer zu ideologischen Gebilden, wenn wir uns nicht der Wahrheit stellen wollen.
Immer mehr Menschen zweifeln aber schon in jungen Jahren an ihrem Geschlecht. Wundert Sie das?
Beim ersten Auftauchen des Phänomens wundert es schon. Zuerst ging es ja in der gesellschaftlichen Debatte jahrelang vor allem um die gesellschaftliche und kirchliche Akzeptanz von Homosexualität. Und mir schien, nachdem diese Akzeptanz weitgehend erreicht war, tauchte auf einmal – aus meiner Wahrnehmung erst vor wenigen Jahren – das Thema der Transidentiät auf. Freilich mit großer medialer und auch akademischer Wucht, als ob es auf einmal das zentrale Thema schlechthin wäre. Auf einmal war also etwas da, worüber davor im Grunde nie gesprochen worden war.
In einer Zeit aber, in der die Verbreitung dieser Idee insbesondere über Social Media läuft, ist es nicht mehr verwunderlich, dass es junge Menschen besonders betrifft. Wir sehen ja, dass es überwiegend junge Mädchen sind. Viele sagen, es sei ein Ansteckungsphänomen. Und das ließe sich – freilich etwas banal gesagt – so beschreiben: In bestimmen Lebensphasen erlebt im Grunde jedes Mädchen ihre körperliche Entwicklung und äußere Erscheinung als problematisch. Und früher hat sie sich vielleicht mit ein paar Klassenkameradinnen verglichen, die genau so normal waren wie sie selbst. Heute vergleicht sie sich mit tausenden von jungen Mädchen auf Instagram, die alle viel perfekter aussehen als sie selbst.
Und zugleich gibt es in denselben Medien einen Hype um die Leute, die von sich sagen, dass sie trans seien und ihr Geschlecht gewechselt haben oder wechseln. Dass das viele andere, die ihren Körper nicht mögen, dann zum Nachdenken bringt, ist nun überhaupt nicht mehr schwer verständlich. Aber wie gesagt, das ist etwas schnell dahin gesagt. Denn natürlich gibt es auch das reale Phänomen der Geschlechtsdysphorie, das in der Lage ist, großes Leid zu verursachen. Und hier braucht es tatsächlich Hilfestellung und Begleitung.
Was mir aber in dem Zusammenhang noch wichtig ist: Die technologische Revolution führt dazu, dass wir uns immer mehr in einem virtuellen Raum aufhalten, in dem ganz viel möglich ist und viele Bedürfnisse schnell und unmittelbar gestillt werden können. Die Welt steht einem im Internet scheinbar beliebig zur Verfügung – auch die materielle Welt. Ich kann ja auch ganz schnell einkaufen oder mir Medikamente und Kleidung im Netz besorgen etc. Dies führt nach meiner Einschätzung bei vielen, vor allem bei jungen Menschen, zu einem neuen, ziemlich umfassenden Weltverhältnis.
Ich sehe darin eine Wiederkehr der Gnosis in moderner Variante, also einer das Christentum immer schon bedrohenden Einstellung, die das Geistig-Immaterielle über das Materielle stellt, so dass das Materielle vor allem zur niederen Verfügungsmasse des Geistes wird. Der Leib wird entwertet zum bloßen, stets verfüg- und manipulierbaren Gegenstand. Diesen Hintergrund darf man bei der Debatte um das Geschlecht auch in Anschlag bringen. Wir Christen betonen dagegen die ungeheuere Würde auch des Leibes. Warum? Unser Gott „ist Fleisch geworden“ (Joh 1,14)
Wo sehen Sie derzeit den Kernauftrag der Christen, um mit Phänomenen wie der Genderbewegung umzugehen?
Zunächst einmal – meine ich – müssen wir verstehen lernen, was dahinter liegt. Welche Not, welche Fragen, aber auch welche Ideologie. Wir müssen uns Menschen, denen die Genderfragen zur Ideologie geworden sind, in jedem Fall nähern mit dem Versuch zuerst einmal zu verstehen. Denn in den dahinter liegenden Fragen bringt im Grunde jeder immer auch sich selbst mit – mit seinen eigenen Fragen, seinem eigenen Umgang, seinen eigenen Wunden auch in den Themen, Sexualität und Geschlecht.
Eine weitere Tatsache ist dann ja auch, dass in alledem wieder ein Schritt des Weges liegt, den Menschen insgesamt besser zu verstehen. Auch große philosophische Entwürfe oder Richtungen haben, auch dann wenn sie aus christlicher Sicht gewissermaßen „häretisch“ waren, dennoch immer dazu beigetragen, den Menschen besser verstehen zu lernen – und sei es in der adäquaten Auseinandersetzung damit. Können wir denn im Gespräch mit dieser Gedankenwelt der Gendertheorien auch etwas lernen – und dann auch die eigenen christlichen Positionen neu und tiefer sagen? Ich bin überzeugt, dass wir Antworten haben, aber wir müssen sie auch finden und uns aneignen.
Beispielsweise glauben wir, dass das, was wir Person-sein nennen im Sinne des „Werde, der du bist“ oder auch im Sinn des Erlösungsverständnisses, von gängigen humanwissenschaftlichen Theorien oder auch von Gendertheorien gar nicht erfasst werden. Was bedeutet es etwa, wenn Paulus davon spricht, dass der, der in Christus ist, „eine neue Schöpfung“ ist (2 Kor 5,17)? Dieses Neu-werden oder auch Neu-geboren-werden (vgl. Joh 3,3) bedeutet ja mit einiger Sicherheit, dass es nicht nur ums Denken geht, sondern im tiefen Sinn um mein eigenes Verhältnis zu Gott, zur Welt, zu den anderen Menschen und zu mir selbst. Und das schließt doch wohl notwendig und immer mein Verhältnis zu meinem Leib mit ein! Und die Geschichte der Heiligen zeigt auch, dass es in christlicher Anthropologie um ein mehr „Ganz-werden“ des Menschen geht, um ein Heiler- und Heiliger-werden.
as ist nun eine Kategorie, die weder eine Gender-Theorie noch andere Humanwissenschaften auf dem Schirm hätten. Aber sie ist eine so wesentliche Antwort oder christliche Zugabe für das Nachdenken über den Menschen in seinem Selbstverhältnis. Wir können sogar sagen: Jeder Mensch ist berufen, eine Art Sakrament zu werden – denn durch ihn als einem endlichen Zeichen soll Gottes Liebe in die Welt kommen. Wie ließe sich aber so etwas in den Humanwissenschaften formulieren, in denen zudem ein viel weniger tiefes Verständnis von Liebe vorherrscht.
Was hilft Priestern im Umgang mit Menschen, die mit dem Schöpfer hadern, die Balance zu halten zwischen notwendiger Abgrenzung von Irrtümern und Fehleinschätzungen und seelsorglicher Zuwendung?
Ich weiß nicht, ob es eine generelle Antwort gibt. Mir hilft immer mich zu fragen, ob ich einigermaßen „in der Liebe“ bin. Also in meinem Bemühen, eine Antwort auf die ungeschuldete Liebe Gottes zu geben und daraus zu leben. Parteiische Liebe ist das Normale unter uns als Unerlöste. Aber sie führt gerade deshalb, weil sie parteiisch ist, im Grunde nie wirklich zur Wahrheit über den Menschen. Absichtslose Liebe, die wirklich den Anderen als Anderen meint, sieht viel eher die Wahrheit, als eine Liebe, die nur für sich sehen will, was ihr grad nützt oder gut tut.
Was also tut dem Anderen als Anderen gut – und nicht dem Anderen als dem „Objekt“ meines Bekehrungsbemühens? Kann ich mit ihm ein Verhältnis aufbauen, so dass er mir vertraut? Und kann ich ihm dann die Wahrheit, die aus unserer Glaubensüberzeugung kommt, auch zumuten? Aus der Qualität dieser Beziehung heraus? Und immer mit dem Eingeständnis, dass ich selbst auch ein erlösungsbedürftiger Sünder bin? Aber im Augenblick, in dem ich das formuliere, merke ich auch, dass es zugleich wichtig ist, dass wir in unseren anthropologischen Grundüberzeugungen auf einigermaßen sicherem Terrain unterwegs sind. Und das sehe ich in vielen kirchlichen Kontexten leider immer weniger.
Wenn Sie jemanden von der Gutheit der Schöpfung überzeugen möchten – wie würden Sie ansetzen?
Ein Beispiel habe ich oben schon genannt, mit dem kleinen Kind, dem wir die Welt normalerweise als gut, wahr und schön präsentieren. Ein zweites Argument wäre die Erkennbarkeit der Welt: Wir können aus der Welt heraus Wahrheit erkennen. Jedes Ding ist es selbst und als solches erkennbar und daher wahr. Wir sind dafür gemacht, solche Wahrheit zu erkennen und zu sagen. Und Wahrheit erkennen zu wollen, ist ein Gut, hat also schon moralische Qualität. Und einander die Wahrheit mitteilen, ist ein Gut zwischen uns.
Denn die Lüge zu sagen oder zu leben ist umgekehrt im Normalfall eben nicht gut! Sie verhindert zwischenmenschliche Verständigung. Sie zerstört Dialog und Begegnung. Das heißt: Wir brauchen im Grunde notwendig eine „metaphysische Auffassung“ von Welt, die uns sagt: Es gibt erkennbare Wahrheit, die wir nicht einfach in die Welt hineinlegen und dann nach unserem Belieben aus ihr herauslesen. Sondern Welt ist in sich wahr und erkennbar. Und dazu gibt es zugleich die Dimension des Miteinanders, in dem die Wahrheit nicht eliminierbar ist, ohne unser Miteinander zu gefährden und zu zerstören. Und auf dieser Basis führt im Grunde jeder Mensch sein Leben und seine Beziehungen. Jeder ist im Grunde, ob er will oder nicht, ein Metaphysiker des Guten und Wahren.