Ein hoch umstrittenes Thema: Können Frauen in der Katholischen Kirche zu Priesterinnen geweiht werden. Beim Synodalen Weg gibt es dazu Texte, die die Weihe für Frauen vehement fordern und die dies auch theologisch intensiv begründen. Ich möchte zunächst sagen: Die Frage nach der Diakonenweihe für Frauen halte ich für offen – und erwarte darüber eine Entscheidung des Lehramtes. Die Priesterweihe ist dagegen aus meiner Sicht nicht möglich. Ich habe im folgenden langen Video-Vortrag versucht zu sagen, warum das so ist. Unter dem Video findet sich auch der Text zum Nachlesen, insbesondere für Schriftstellen und andere Zitate.
Hier die Gliederung
0. Einleitung
1. Gott allein liebt absichtslos: 6:20
2. Heile Welt: 9:25
3. Gebrochene Welt: 11:28
4. Der Bund Gottes und der Bund der Menschen untereinander: 20:14
5. Der Bund als Hochzeit: 31.28
6. Jesus der Bräutigam und das Gottesvolk als Braut: 34:16
7. Die Menschwerdung und die absichtslose Liebe: 51:06
8. Wort und Antwort: 1:05:22
9. Die Weite des Herzens: 1:13:27
10. Teilhabe an klerikaler Macht? 1:23:44
—
Der Synodale Weg V – Die absichtslose Liebe und die Frage nach dem Priestertum der Frau
Im Forum III des Synodalen Weges geht es um „Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche“. Die dritte Synodalversammlung hat mit großer Mehrheit in erster Lesung einen Grundtext dazu verabschiedet. Das ist ein Text, der ausgehend vom Blick auf unsere Zeit und Gesellschaft, auf die Bibel, auf die Theologie und ihre Geschichte, auf die Ökumene und anderes ein großes Ziel verfolgt: die Geschlechtergerechtigkeit in unserer Kirche. Darunter verstehen die Autoren und Autorinnen ganz besonders den Zugang von Frauen zu allen Ämtern der katholischen Kirche, insbesondere zum Dienst des Priesters.
Das Ziel ist also klar formuliert, das heißt alle genannten Bereiche, aus denen man Argumente für das Ziel gewinnt, werden vor allem mit diesem Erkenntnisinteresse betrachtet: Kann ich möglichst viele und gute Argumente dafür finden, dass Frauen endlich Zugang zu den Ämtern finden. Ich bin der Meinung, es ist sehr redlich, dass dieses Erkenntnisinteresse klar formuliert ist, und der daraus erwachsene Text hat unbestritten auch theologische Qualität, freilich unter diesem besonderen Blickwinkel, der dann konsequent auch andere Blickwinkel ausblendet.
Denn die meisten, die das hier hören, lesen oder sehen, wissen, dass es bislang in der Katholischen Kirche keine Priesterinnen gibt. Und die allermeisten Menschen in- und außerhalb unserer Kirche haben dafür auch kein Verständnis mehr. Für viele Menschen, vor allem auch für viele Frauen, ist es oft auch ein Grund, die Kirche zu verlassen, manchmal sogar den Glauben. Und nicht wenige Menschen, auch Bischöfe, sagen, an dieser Frauenfrage entscheidet sich die Zukunft der Kirche. Mit der Vermutung: Wenn sich hier nicht bald etwas ändert, wird die Kirche in unserem Land oder im ganzen Westen, eine verschwindende, marginalisierte Größe werden.
Ich möchte nun mit diesem Video einen anderen Weg einschlagen – mit einem anderen Erkenntnisinteresse, das ich deshalb gerne auch von vorneherein offenlege, um möglichst transparent zu sein. Ich fühle mich als gläubiger Katholik und weiß als solcher, dass die Frage nach dem Zugang von Frauen zum Priestertum in der gesamten Kirchengeschichte immer wieder ein Thema war. Womöglich nie so groß und breit diskutiert wie heute, aber immer schon hat man sich gefragt, warum dieses Amt nur für dazu berufene Männer zugänglich ist und Argumente dazu vorgelegt. Und Papst Johannes Paul II. hat dann in der Ausübung seines Lehramtes mit höchster Autorität im Jahr 1994 bekräftigt, dass „dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. (Ordinatio sacerdotalis 4)“. Nach meiner Einschätzung hat der Papst damals – so wie er die Sache selbst formuliert hat – ein unfehlbare Lehrentscheidung getroffen. Ob sie unfehlbar war, ist theologisch durchaus bei vielen Fachleuten umstritten. Der Papst selbst aber hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er hier unfehlbar sprechen wollte. Denn er hat betont, dass dieser Vorbehalt des Priestertums für berufene Männer 1. von Gott selbst so gewollt sei und daher 2. auch zum so genannten Glaubensgut der Kirche gehöre. Das will sagen: Mit seiner Entscheidung, dass das nun endgültig so zu glauben und zu halten sei, bekräftigt der Papst nicht etwas Neues, sondern etwas, was in der Kirche immer und überall und von allen so geglaubt und gelebt wurde. Das heißt nun aber auch: Selbst die kritischen Theologinnen und Theologen, die anzweifeln, dass der Papst hier unfehlbar gesprochen hat, räumen ein, dass diese Aussage von Johannes Paul II. trotzdem höchstes Gewicht hat – und dass ein Nachfolger nur sehr, sehr schwer daran vorbeikommt, womöglich nur mit der Autorität eines neuen Konzils. Ich meine, dass kein Nachfolger daran überhaupt vorbeikommt. Das heißt: Man kann zwar darüber diskutieren, ob die angeführten Argumente stark oder schwach, gut oder weniger gut sind, aber an dieser Entscheidung ist aus meiner Sicht nichts mehr zu ändern. Und wollte man es ändern, kann ich es mir nicht anders vorstellen als unter dem Preis eines Los von Rom oder eines erneuten Schismas in der Kirche. Denn es wird dann neben denen, die gehen, notwendig auch viele geben, die an dem festhalten wollen, was Johannes Paul II. erklärt hat.
Anders verhält es sich übrigens mit dem Diakonat der Frau: Hier gibt es viele Argumente dafür und dagegen. Ich bin in dieser Frage nicht völlig entschieden. Ich habe eine Meinung dazu, aber theologisch scheint mir die Frage viel offener zu sein, als bei der Priesterweihe. Und daher meine ich, dass wir auch hier ein klärendes Wort aus Rom brauchen. Ich will dieses Thema Diakonat in diesem Video aber nicht vertiefen.
Mein Erkenntnisinteresse in diesem Video ist ein anderes: Ich möchte verstehen und verdeutlichen, warum es so ist, wie es unsere Kirche von Anfang an bis heute sagt und lebt. Und möchte aus meiner eigenen philosophischen und theologischen Überzeugung Argumente dazu legen. Und zwar wieder mit dem Blick auf die innere Mitte von allem, was unseren Glauben an Christus ausmacht: die absichtslose Liebe Gottes zu uns Menschen und zu seiner Schöpfung. Darüber habe ich schon in den anderen Videos zum Synodalen Weg gesprochen. In diesem Video möchte ich zeigen, was das mit unserer Frage nach der Weihe der Frau zu tun hat.
-
Gott alleine liebt absichtslos
Unser Glaube und die Erfahrung mit Gott in unserer Kirche sagen uns: Gott braucht uns nicht. Gott braucht die Schöpfung nicht. Das meint: Er ist nicht bedürftig nach Liebe, nach Anerkennung. Er braucht also nicht, dass wir ihn fortwährend feiern und anbeten. Er ist absolut in sich und aus sich glücklich, absolut frei, absolut gut. Das heißt: Wenn er die Welt erschafft und jeden von uns, dann tut er es nicht, weil ihm ohne uns langweilig wäre. Er tut es einfach, weil seine Güte überströmt vor schöpferischer Liebe. Er will die Schöpfung in die Welt lieben, damit sie ist und damit sie wahr, gut und schön ist, so wie er. Damit sie in all ihrer Fülle, Güte und Schönheit etwas widerspiegeln möge von Seiner Güte, Wahrheit und Schönheit. Und eben aus diesem Grund hält er die Schöpfung in jedem Augenblick in der Existenz. Alles, was es gibt – einschließlich jeden von uns – gibt es nur, so glauben wir, weil er es liebt. Und er will besonders uns Menschen. Und er will uns Anteil geben, an seinem liebenden und glückseligen Leben.
Dieses Leben finden wir als Menschen, wenn wir Gott finden und lernen, Gott zu lieben – und in Ihm die Menschen und Gottes Schöpfung – und uns selbst. Der Mensch tritt dann gewissermaßen ein in Gottes Zuwendung zur Welt, in seine überströmende Liebe. Er tritt innerlich ein in dieses Geheimnis allen Seins und lernt daraus, auch Gott selbst, die Menschen und sich selbst zu lieben. Wenn das von innen her geschieht, dann ereignet sich schon heute in Dir und mir etwas von diesem glückseligen Leben, vom Anfang des Himmels.
Aber, meine Lieben, wir spüren ja, dass gerade das: Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst, eine riesen Herausforderung für uns ist. Denn viel zu wenig sind wir ihm darin ähnlich, obwohl wir doch ihm ähnlich geschaffen sind, wie die Bibel sagt. Aber viel zu sehr drehen wir uns um uns selbst und stecken fest in der Überzeugung, dass wir es selbst in der Hand haben und selbst unseres Glückes Schmied sind und selber die Meister und Herren unseres Lebens. Und letztlich spielen wir darin selber Gott. Denn diese Haltung, dieses Kreisen um mich selbst, meine Egozentrik, die meint sich selbst zum Maßstab des Lebens, zum Maßstab von Gut und Böse machen zu können, ist nach unserem Glauben die Ursache von allem Übel – von Streit, von Krieg, von Lüge, von Mord, letztlich sogar von Krankheit und Tod. Die Christen glauben, der Mensch braucht Erlösung vom Egoismus, damit er von neuem hineinfindet in Gottes Liebesstrom, der die Welt erhält.
-
Heile Welt
Wenn wir auf die bildreichen Erzählungen vom Anfang der Welt in der Bibel schauen, dann wird uns heile Welt gezeigt, heile Schöpfung. Die Bilder schildern uns den Menschen, wie er zunächst auch im heilen Verhältnis zu seinem Schöpfer lebt. Seinen Lebensatem hat er unmittelbar vom Schöpfer eingehaucht bekommen (Gen 2,7). Der Mensch darf den anderen Geschöpfen ihren Namen geben, das heißt, er erkennt sie in dem, was der innere Sinn ihres Daseins ist. Er ist hier eine Art Mittler vom Schöpfer zu den Mitgeschöpfen hin und umgekehrt. Er bezieht die Mitgeschöpfe auf sich hin, um mit ihnen zusammen den Schöpfer zu ehren. Der ursprüngliche Mensch ist im Garten Eden also eine priesterliche Gestalt. Aber weil der Mensch für sich selbst noch keine Entsprechung hat, lässt ihn Gott in einen tiefen Schlaf fallen, und erschafft ihm aus seiner Seite, gewissermaßen aus der Herzensöffnung, eine ihm ebenbürtige Gefährtin, ein Gegenüber – als männlich und weiblich (vgl. Gen 2,18-26) schuf er sie, heißt es in der Schrift. Und alles an diesen beiden ist noch heil, auch ihre sexuelle Vereinigung, ihre unschuldige Nacktheit, das Fehlen der Scham voreinander. Das heißt: Die Erzählungen von der heilen Welt des Anfangs in den ersten beiden Kapiteln der Bibel schließen und gipfeln gewissermaßen mit der Schilderung einer Hochzeit, mit der Schilderung eines heilen Verhältnisses von Mann und Frau, die beide in ihrem Zueinander und Miteinander als Gottes Ebenbilder und in seinem Auftrag wirken, indem sie die Schöpfung kultivieren, fruchtbar sind und sich in ihr vermehren.
-
Gebrochene Welt
Erst jetzt schildert die Schrift die Geschichte der Versuchung, die Geschichte vom Ungehorsam gegen Gott durch die Verführung der geheimnisvollen Gestalt der Schlange, des Bösen. Das Menschenpaar lässt sich verführen und die Folge ist, dass sofort alle drei Verhältnisse kaputt gehen oder wenigstens korrumpiert werden. Der Mensch schämt sich, im Selbstverhältnis, schämt sich vor dem anderen und vor Gott, der ihn jetzt im Garten suchen muss. Diese ursprüngliche Gebrochenheit, die aus dem Bruch der Gottesbeziehung kommt, bricht auch das heile Verhältnis zwischen Mann und Frau: „nach deinem Mann hast du Verlangen, er wird über dich herrschen“ (Gen 3,16), sagt Gott. Der Satz ließe sich so deuten: Wenn es zuvor ein heiles, unschuldiges Begehren der beiden füreinander gegeben hat, dann ist dieses Verhältnis jetzt getrübt und von Scham geprägt. Es ist von gegenseitiger Schuldzuweisung („Eva war es, die Schlange war es“ vgl. Gen 2,12-13), von Unterwerfung und Machtausübung beeinflusst und besetzt. Begehren ist nicht mehr unschuldig und verselbständigt sich aus einer heilen Mitte. Und auch das Verhältnis zum Schöpfungsauftrag ist nicht mehr paradiesisch: Die Kindergeburt bereitet Schmerzen, der Ackerboden ist verflucht, nur in Mühsal kommt der Mensch zu seinem Lebensunterhalt. Das Paradies ist verlassen, Cherubim bewachen es mit dem lodernden Flammenschwert (vgl. Gen 3). Das heißt: Aus eigener Kraft kommt der Mensch nicht mehr zurück. Oder im Anschluss an das, was ich über die schöpferische Kraft der absichtslosen Liebe gesagt habe: Der Mensch ist aus sich selbst kaum mehr fähig zu dieser Liebe, weil er mit dem Paradies gewissermaßen den inneren Boden verlassen hat, der ihn trägt und dazu befähigt. Die Ur-Beziehung mit seinem Schöpfer ist gebrochen. Der Boden, der ihn jetzt – wenn auch nur vermeintlich – trägt, ist der Boden eines Selbstseins, das sich primär in den geschaffenen Dingen dieser Welt behaupten muss – und oft auch gegen sie behaupten muss.
Wir sehen an diesen Darstellungen: Die Frage nach der Erlösung zielt auf das tiefe Wechselverhältnis von Gottesverhältnis, Selbstverhältnis und Verhältnis zum Nächsten und zur Schöpfung. Keines dieser Verhältnisse ist loslösbar von den jeweils anderen, vielmehr legt jedes Verhältnis die anderen mit aus. Man könnte sagen: Zeige, wie du zum anderen Menschen stehst – und darin ließe sich zeigen, wie du zu Gott stehst. Zeige, wie du zu Gott stehst und darin ließe sich sagen, wie du zu dir selbst und zum anderen stehst. Und so weiter. Alle Beziehungen hängen mit den anderen zusammen. Aber eine vielleicht entscheidende Erkenntnis an dieser Lesart der Schöpfungsgeschichte im Blick auf das, was biblisch noch kommt, ist dieses: Der Ort des Bruches im Gottesverhältnis ereignet sich auch im Verhältnis der Geschlechter zueinander, dort wo Adam und Eva als Ebenbilder Gottes mit Ihm schöpferisch mitwirken sollten. Adam und Eva lassen sich miteinander zum Ungehorsam verführen. Die verwundbare Flanke für den Eintritt des Versuchers ins Innere des Menschen sind hier das Selbstverhältnis der Frau und das Verhältnis des Mannes zur Frau. Sie ist beeindruckt von der Klugheit der Schlange – und möchte auch diese Art von Klugheit gewinnen. Und er ist dabei, wie es heißt; aber offenbar ist er nur dabei – ohne tiefer nachzudenken und ohne innerlich schützend oder stärkend bei seiner Frau zu sein. Vielmehr lässt er sich dann von ihr ebenfalls die verbotene Frucht geben. Zwei Dinge zerbrechen darin: Der liebende Gehorsam zu Gott und das Verhältnis der Menschen zueinander durch Verführung von außen. Schon die Kirchenväter haben gesehen, dass dieser Ungehorsam der Menschen durch einen Gehorsam aus Liebe geheilt werden musste, der dann zugleich das heile Verhältnis zwischen Mann und Frau wieder herzustellen vermag. Das werden wir dann am Erlöser sehen.
Und wenn wir die Schilderung des schöpferischen Aktes der Entstehung des Menschenpaares noch einmal betrachten, dann erzählt uns die Schrift, wie Gott den Menschen in einen tiefen Schlaf fallen ließ; wie er aus der Rippe des Menschen eine Frau erschafft und sie dann dem Menschen zuführt. In dieser Darstellung wird sichtbar: Gott handelt allein. Das als neu erlebte Zueinander von Mann und Frau wird überraschend, beglückend und geschenkhaft erfahren: „Endlich!“ (Gen 2, 23), sagt Adam. Dieses alleinige Handeln Gottes ließe sich dahingehend deuten, dass das erlebte Glück der Begegnung vom Menschen nicht inszeniert war, auch nicht von Macht und (negativem) Begehren erzwungen oder manipuliert war. Die beiden erleben sich in ihrer Unterschiedenheit trotzdem tief aufeinander bezogen – und werden so „ein Fleisch“. Und das Wort „Fleisch“ ist an dieser Stelle, paradiesisch sozusagen, noch nicht negativ gemeint. Der Mensch als Leib und Seele ist noch ganz, noch heil. Im Grunde kann man sagen: Hier ereignet sich zwischen den beiden absichtslose Liebe. Beide schenken sich einander, ohne einander beherrschen zu wollen, ohne sich voreinander zu schämen, ohne auch Probleme zu haben, mit der Annahme ihrer selbst. Aus dem heilen Gottesverhältnis heraus, sind sie in ihrem Zueinander heil – und finden auch ihre tiefere Identität im Verhältnis zum jeweiligen Gegenüber – jetzt heißt es, dass sie auf hebräisch „isch“ und „ischa“ sind – Mann und Frau und nicht mehr nur Mensch. Der Zwischenraum ihrer Liebe, ihres Ja zueinander, lebt aus der Gegenwart Gottes, aus dem Getragensein von Seiner Liebe, die die beiden umhüllt und unterfängt – und einander zuführt und zugleich zu sich selbst bringt.
Und das bedeutet im Rückschluss wieder: Der Bruch des Gottesverhältnisses führt zum problematischen Verhältnis der Geschlechter zueinander – und zum Bruch des einzelnen Menschen im Verhältnis zu sich selbst. Und ich würde hinzulegen: auch in seinem je eigenen Mann- oder Frau-sein, weil ursprünglich ein gegenseitiges aufeinander Verwiesen-sein als Mann und Frau beschrieben ist. Die Frage ist: Kann ich in dem Vertrauen leben, dass ich wirklich getragen und geliebt bin? Und dass mir das Entscheidende im Leben, gelingende Beziehungen, tiefe Glücks-Erfahrungen, Liebe, Vertrauen, Verlässlichkeit, Sinn, etc, kann ich vertrauen, dass mir alles das geschenkt wird, weil ich mich im ursprünglichen Sinn getragen weiß? Oder – wenn ich nicht vertrauen kann – muss ich mir dann nicht zum Beispiel durch Machtausübung, Eifersucht, Manipulation, Besitzergreifung und Begierde die Dinge so sichern, dass sie meinen Wünschen entsprechen, einschließlich der Menschen und meiner Beziehungen zu ihnen? Wir ahnen vielleicht, wenn ich aus der absichtslosen Liebe Gottes leben lerne, weil ich von Ihm selbst berührt bin, kann die Tür zum Paradies schon hier und heute wieder aufgehen. Aber das bedeutet zugleich die innere Abrüstung von einem Machtanspruch, vom Anspruch der Manipulation und der Besitzergreifung. Es bedeutet auch eine Integration meines Begehrens in seine ursprüngliche Ordnung hinein. Und es bedeutet ein tieferes Hineinfinden in eine Identität, die aus der gläubigen Erfahrung kommt, einen Vater (im Himmel) zu haben.
-
Der Bund Gottes und der Bund der Menschen untereinander
Von hier aus möchte ich mit Ihnen nun über die große Kategorie des Bundes sprechen, der die ganze Schrift durchzieht. Unsere ganze Bibel ist Bundeszeugnis, ist Alter Bund und neuer Bund, ist Altes Testament und Neues Testament. Und die Rede vom Bund bedeutet von vorne bis hinten, dass Gott von sich her darauf aus ist, den Menschen aus dem Bruch des Verhältnisses zu ihm wieder zurückzuholen in die Verbundenheit mit ihm. Gott macht immer neu den ersten Schritt. Die Schrift erzählt, dass dies durch Erwählung passiert von einzelnen Männern und Frauen, die ihrerseits dann wieder eine Sendung für die Vielen haben, um die Vielen zu Gott zurückzuführen. Die Bundesschlüsse ereignen sich in besonders herausragender Weise mit Noah, mit Abraham, Isaak und Jakob, mit Mose, mit David und Salomo – in stetig wachsender Bedeutung – zumindest von Abraham an: Aus dem Bund mit einer Familie, wird ein Bund mit einem Volk aus zwölf Stämmen, wird ein Bund mit einem Königreich, der dann Bedeutung hat für alle anderen Völker und Königreiche.
Und eine der zentralen Kategorien, durch die sich der Bund jeweils ausdrückt, ist der rechte Kult, der rechte Gottesdienst. Es ist der rechte Vollzug der Verehrung Gottes. Diesen Vollzug fordert sich Gott als der Bundespartner ein. Zumal sich Gott seinerseits zur Treue verpflichtet. Wir können auch sehen, wie es immer neu, immer wieder und im Gang durch die Schrift und durch die Zeit immer tiefer um ein Bundesverhältnis geht, das auf den inneren Menschen zielt und den Menschen so als Bundespartner von innen her erneuert und würdig macht. Oder anders gesagt: Es wird zunehmend deutlich, dass Gott den Menschen als wirklichen Partner und Freund in seinem Bund will.
Abraham etwa bekommt die Beschneidung als Bedingung und als Zeichen für die Zugehörigkeit von ihm und seinen männlichen Nachkommen zum Bund mit Gott. Der praktische Sinn der Beschneidung wurde häufig in der jüdischen Tradition gedeutet als ein Mittel, um die sexuelle Begierde des Mannes einzudämmen. Sofern diese oft wiederkehrende Deutung zutrifft, würden wir hier einen ersten unmittelbaren Zusammenhang sehen zwischen dem mehr oder weniger gelingenden Verhältnis der Geschlechter zueinander und ihrem Verhältnis zu Gott. Und in der prophetischen Tradition wird Jeremia dann betonen, dass „Beschneidung“ tiefer verstanden bedeutet: „Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhaut eures Herzens“ (Jer 4,4). Die eigentliche Erneuerung für den Bund ist also eine des inneren Menschen. Paulus wird später dieses Motiv von der Beschneidung des Herzens häufiger aufgreifen (vgl. Röm 2,29; Kol 2,11) in seiner Überzeugung, dass der, der in Christus ist, tatsächlich von innen her: „neue Schöpfung“ ist (Gal 6,15).
Die Ursünde Israels – und ein folgenreicher Bundesbruch – ist am Sinai der Tanz um das goldene Kalb. Dieser Götzendienst führt unmittelbar im Anschluss dazu, dass die Israeliten danach „aufstanden um sich zu vergnügen“ (Ex 32,6) – was mit einiger Eindeutigkeit unsittliches Verhalten bedeutet. Auch dies bestätigt Paulus, indem er es „Unzucht“ nennt. Und dies führt zusammen mit der Strafe für den Götzendienst zum Tod von 3000 Menschen (vgl. 1 Kor 10,3 und Ex 32,28). Auch hier also wieder der Zusammenhang zwischen verfehltem sexuellem Verhalten und der verfehlten Gottesverehrung und umgekehrt.
Die Liste ließe sich leicht und lange fortsetzen. Die Landnahme, die im Buch der Richter geschildert wird, gelingt nicht in der von Gott gewollten Vernichtung der eroberten Völker oder wenigstens in der Trennung von ihnen (vgl. Ps 106, 34-36). Vielmehr führt die zunehmende Vermischung der Israeliten, die sich Frauen aus den Völkern Kanaans nehmen, immer wieder zum Götzendienst (vgl. etwa Ri 3,6).
Die Samuelbücher beginnen mit der Erzählung von der Geburt des Propheten Samuel, der im Heiligtum Schilo dem alten Priester Eli anvertraut wird. Allerdings sind dessen Söhne Hofni und Pinhas korrupte Priester, die sowohl den Opferkult missbrauchen (vgl. 1 Sam 2,17) wie sie auch betende Frauen sexuell ausbeuten (vgl. 1 Sam 2,22). Ihr Verhalten führt letztlich zur Katastrophe: Israel wird im Krieg geschlagen und das Allerheiligste, die Bundeslade, wird dabei von den Feinden erbeutet. Die Priesterfamilie Elis wird ausgelöscht. (vgl. 1 Sam 4)
Insbesondere das Verhalten von David, dem großen priesterlichen König und eigentlichen Liebling im erneuerten Bund mit Gott (vgl. Ps 89, 4-5) ist einschlägig. Seine ungeordnete Begierde nach Bathseba führt zum Ehebruch und zum Mord an deren Mann Urija. Der Prophet Natan richtet daher dem David im Auftrag Gottes die Konsequenz aus, nämlich dass „das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus weicht“ (2 Sam 12,7). Davids Verhalten hat tatsächlich wüste Konsequenzen, die in Teilen auch wieder sexuell konnotiert sind: Innerhalb seines Hauses vergewaltigt sein Sohn Amnon dessen Halbschwester Tamar und wird danach von Abschalom, einem weiteren Sohn Davids ermordet (vgl. 2 Sam 13). Dieser Abschalom wird später David nach dem Leben trachten und ihn insbesondere dadurch demütigen, dass er in Davids Harem mit dessen Nebenfrauen schläft (vgl. 2 Sam 16,22). Auch hier wiederholt sich: Sittliche Vergehen bei den Auserwählten trüben das Gottesverhältnis: David selbst darf den großen Tempel in Jerusalem, nur mehr vorbereiten, aber nicht mehr bauen (vgl. 1 Chr 22,8).
Der von Gott bestätigte und erwählte Sohn Davids ist König Salomo. Er baut den Tempel, in den die Herrlichkeit Gottes Einzug hält (vgl. 2 Chr 7,1). Salomo wird aufgrund seiner Demut und der Bitte um ein hörendes Herz am Beginn seiner Regierungszeit (vgl. 1 Kön 3,9) von Gott mit Weisheit gesegnet und mit Reichtum überschüttet. Aber auch Salomon bricht den Bund durch sexuelle Verfehlungen: Seine zahlreichen Nebenfrauen verführen ihn zur Verehrung anderer Gottheiten (1 Kön 11, 1-13). Wieder scheint hier der Zusammenhang auf zwischen rechtem sittlichem Leben zwischen Mann und Frau und der rechten Gottesverehrung. Das unsittliche Leben lässt die Herzensfähigkeit Salomos, die Stimme des Herrn zu hören, verschwinden. Die Folgen sind wieder katastrophal: Das Königtum und mit ihm die Einheit des Volkes zerfällt in zwei Herrschaftsbereiche. Das Nordreich beginnt mit eigenen Kultformen und verfällt immer neu dem Götzendienst, insbesondere der berüchtigte König Ahab, der mit der Heidin Isebel verheiratet ist und durch sie verführt wird, den Baal zu verehren (vgl. 1 Kön 21,25).
Nach der Katastrophe der Zerstörung Jerusalems und der Heimkehr aus der Babylonischen Gefangenschaft lässt der Priester Esra den Tempel wieder aufbauen und wird sogleich mit dem Problem der Mischehen und dem daraus folgenden Götzendienst konfrontiert (vgl. Esra 9 und 10). Esra lässt die Mischehen der Israeliten auflösen – und sucht so, die Reinheit des Kultes und des Bundes (vgl. Esra 10, 3) wieder herzustellen. Auch der letzte Prophet des Alten Bundes, Maleachi, klagt die Korruption des Kultes an und bringt sie unmittelbar mit konkreter Praxis des Ehebruchs in Verbindung (vgl.Mal 2,10-16): „Treulos hat Juda gehandelt und Gräueltaten sind in Israel und in Jerusalem geschehen: Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn, das er liebt entweiht – und die Tochter eines fremden Gottes zur Frau genommen.“ Und warum schaut Gott nicht mehr auf die dargebrachten Opfer im Kult? „Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos handelst, obwohl sie deine Gefährtin ist, die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast.“ (Mal 2, 14).
Schließlich ein letztes Wort aus der Weisheitsliteratur des Alten Bundes, das diesen Zusammenhang ebenfalls beim Namen nennt: „Das Ersinnen von Götzenbildern war Anfang der Untreue, ihre Erfindung führte zur Sittenverderbnis.“ (Weish 14,12). Und im selben Sinn noch drastischer gezeichnet: „Alles ist ein wirres Gemisch von Blut und Mord, Diebstahl und Betrug, Verdorbenheit, Untreue, Aufruhr und Meineid; es herrscht Umkehrung der Werte, undankbare Vergesslichkeit, Befleckung der Seelen, widernatürliche Unzucht, Zerrüttung der Ehen, Ehebruch und Zügellosigkeit. Die Verehrung der namenlosen Götzenbilder ist aller Übel Anfang, Ursache und Höhepunkt.“ (Weish 14,25-27)
Sucht man im Neuen Testament nach dem hier angesprochenen Zusammenhang, dann wird man an mehreren Stellen fündig, insbesondere bei Paulus, der gleich am Anfang des Römerbriefes einen tiefen Zusammenhang herzustellen weiß zwischen der rechten Gottesverehrung und dem rechen sittlichen Leben, bzw. umgekehrt: Zwischen der verfehlten Hinwendung zu Gott und der daraus folgenden Verfinsterung des Herzens, die zur sittlichen, insbesondere sexuellen Verfehlung führt. „Denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein, und wurden zu Toren. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, vierfüßige und kriechende Tiere darstellen. Darum lieferte Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, sodass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers — gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus: Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen; ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander; Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung.“ (Röm 1,21-27) Paulus macht aber noch auf einen anderen Zusammenhang aufmerksam: Im Neuen Bund sind die Gläubigen Glieder des Leibes Christi und gehören ihm. Sexuelle Verfehlung dagegen ist Versündigung gegen den eigenen Leib, der doch ein Tempel des Geistes sei (vgl. 1 Kor 6,15-20). Auch hier bedeutet also sexuelle Verfehlung zugleich Verunmöglichung der rechten Gottesbeziehung und des rechten Kultes.
-
Der Bund als Hochzeit
Der dargestellte Zusammenhang zwischen dem rechten Verhältnis des geschöpflichen Ur-Bundes zwischen Mann und Frau und dem Bund Gottes mit seinem Volk, drückt sich dann auch in den großen Bildern der Schrift aus. Der Bund zwischen Gott und seinem Volk wird zunehmend personaler beschrieben. Die Propheten des Alten Testaments erwarten einen neuen Bund, der den Menschen ein neues Herz gibt: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ (Ez 36,26) Und bei Jeremia sagt Gott: „So wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn: Ich habe meine Weisungen in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben.“
Aus dem, was noch bei Abraham wie eine archaische Vertragsbindung Gottes an den Erwählten (Gen 15,8-21) erscheint, wird immer häufiger eine Liebesbeziehung, die insbesondere bei den Propheten im Bild einer Ehe geschildert wird. Der Prophet Hosea lässt Gott von der untreuen Frau erzählen, die er trotzdem reinigen und wieder zur Frau nehmen will (vgl. Hos 2,4-17). Auch Ezechiel spricht über Israel als die Braut Gottes, die Gott zunächst großgezogen, dann geheiratet hat, die ihm aber abtrünnig und zur Dirne wurde (vgl. Ez 16). Beim Propheten Jeremia spricht Gott sein Volk als „Jungfrau Israel“ an, die er „mit ewiger Liebe geliebt“ habe (Jer 31,3-4). Und im Jesaja-Buch verheißt der Prophet eine hochzeitliche Zukunft für Zion: „Der Herr hat an dir Gefallen, und dein Land wird vermählt….Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich (Jes 62, 4-6)“. Das ganze Buch „Hoheslied“ ist schließlich ein einziges Liebesgedicht, das von anmutiger und zugleich erotischer Beziehung zwischen zwei Liebenden singt – und das die große geistliche Tradition durch die Jahrhunderte als Allegorie auf die Liebe Gottes zu seinem Volk gelesen hat.
-
Jesus der Bräutigam und das Gottesvolk als Braut
Zieht man die Linien, die hier gezeigt sind, aus ins Neue Testament, zeigt sich – wie in vielen anderen Motiven – das Schema von Verheißung und Erfüllung. Jesus präsentiert sich selbst an mehreren Stellen des Evangeliums (z.B. Mt 9,15; 25,10 parr.) als der eigentliche Bräutigam der Braut, die das erneuerte Gottesvolk ist. Zugleich erneuert Jesus in seinem Erlösungswerk den Bund zwischen Mann und Frau, unter anderem indem er daran erinnert, dass Scheidung und Ehebruch „am Anfang der Schöpfung“ (Mk 10,6) nicht vorgesehen waren – eben weil beide „ein Fleisch“ geworden sind. Paulus wird dann diese beiden Wirklichkeiten – den Bund zwischen Kirche und Christus und den Bund zwischen Mann und Frau – in den Zusammenhang bringen, der hier dargestellt ist: „Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis; ich beziehe es auf Christus und die Kirche.“ (Eph 5,31-32). Der weitere Kontext dieser Stelle im Epheserbrief macht ebenfalls deutlich, dass es einen Zusammenhang gibt, zwischen der rechten Gottesverehrung und dem rechten Verhältnis zwischen Eheleuten: „ Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler; heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst.“ (Eph 5,25-28)
Auch das Johannes-Evangelium lässt sich insgesamt auf dieses Motiv hin lesen: Es geht im Erlösungswerk Jesu um eine Fruchtbarkeit, die als „Neugeburt aus Gott“ bzw. „aus dem Geist“, bzw. „von oben“ (vgl. Joh 1,13; Joh 3,3; 3,6; 3,8) als Folge eines Bundes der Vermählung zwischen Gott und Mensch gedeutet wird. Schon im zweiten Kapitel des Evangeliums sind Jesus und seine Mutter die beiden Protagonisten einer Hochzeit in Kana. Die eigentlichen Brautleute bleiben in dieser Erzählung ganz im Hintergrund. Die Mutter Jesu bittet ihren Sohn, die Not der Weinknappheit zu beheben, woraufhin er sie nicht mit „Mutter“ anspricht, sondern mit „Frau“ – um ihr gleichzeitig zu bedeuten, dass „seine Stunde“ noch nicht gekommen sei. Gleichwohl wirkt er das Wunder der Produktion eines offenbar köstlichen Weines – wohl eine Anspielung des Evangelisten auf den Anbruch des messianischen Zeitalters mit Bezug zu einer Prophetie des Jesaja (vgl. Jes 25,6), in der ein Festmahl „mit erlesenen, reinen Weinen“ beschrieben wird. Die „Stunde“, von der Jesus spricht, wird später die Stunde der Kreuzigung sein, die zugleich in diesem Evangelium seine Verherrlichung ist, in der alles vollbracht und er zum Vater erhöht ist. Der Evangelist schildert diese Vollendung zugleich als Stunde einer „Vermählung“. Denn nun begegnet uns die Mutter Jesu erneut (vgl. Joh 19,25-27) – sie steht bei ihm in dieser Stunde. Er spricht sie wieder als „Frau“ an – und er lässt in diesem Moment gleichsam neue Familienverhältnisse entstehen: „Siehe dein Sohn!“- sagt er über den „Jünger, den er liebte“, der ebenfalls unter dem Kreuz steht, und: „siehe, deine Mutter“. Jesus übergibt beide einander in ein neues, geistliches Verwandtschaftsverhältnis – und erklärt damit zugleich ein Rätselwort, das Nikodemus, der „Lehrer Israels“ (Joh 3,10) zuvor im Evangelium noch nicht verstanden hatte. „Wie kann ein Mensch, der schon alt ist (neu) geboren werden? Kann er etwa in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und noch einmal geboren werden?“ (Joh 3,4), fragt er. Neugeburt geschieht gewissermaßen aus dem Zueinander derjenigen „Frau“, die treu beim Gekreuzigten, jetzt dem Erhöhten steht, der als der Erhöhte „von oben“ (Joh 3,3) „den Geist übergibt“ (Joh 19,30) und aus dessen Seite „Blut und Wasser“ (Joh 19, 34) fließen. Zu Nikodemus hatte Jesus noch gesagt: Neugeburt geschieht „von oben“ und „aus dem Wasser und dem Geist“ (Joh 3, 5).
Der Jünger, den Jesus liebte, wird im Evangelium, ebenso wie die Mutter Jesu, nicht beim Eigennamen genannt. Sie ist die „Frau“ schlechthin, diejenige, in der Gott selbst auf einzigartige Weise „Wohnung“ genommen hat und „Fleisch geworden“ ist (Joh 1,14). Sie ist diejenige, die in offenbar selbstverständlicher Verbundenheit den Weg mit Jesus zu Ende geht, zu einem Ende, das in seiner Vollendung am Kreuz eigentlich ein neuer Anfang ist. Denn alle anderen, die wie der geliebte Jünger Jesus lieben und bei ihm – auch als dem Gekreuzigten bleiben und ihn als Erlöser bekennen, treten in dieses fruchtbare Verhältnis zwischen dem „Bräutigam“ Christus und seiner „Braut“, der „Frau“ ein, die hier als Gestalt der Kirche aufscheint, als der mütterliche „Wohnort Gottes“ in der Welt – und werden selbst neu geboren – von oben und aus dem Heiligen Geist. Das II. Vatikanische Konzil bestätigt in seinem Text über die Kirche diese Deutung der Rolle der Mutter des Herrn. Im letzten Kapitel heißt es dort: „Indem sie Christus empfing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und mit ihrem am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Leben der Seelen. Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter.“ (Lumen gentium 61). Damit ist aber gesagt, dass sie die Mutter aller (!) Begnadeten und Erlösten ist, das heißt: Mutter des ganzen Volkes Gottes.
Der Kreuzestod Jesu ist nun sowohl Inhalt wie Vollendung dessen, was er im letzten Abendmahl als den „neuen Bund in meinem Blut“ (Lk 22,20) gefeiert hat. Die Liebeshingabe, die sich im Brot des Lebens und Kelch des Heiles den Seinen mitteilt, ist erfüllt von seinem gekreuzigten Leib und dem auf Golgotha vergossenem Blut. Alles geschieht „zur Vergebung der Sünden“, das heißt als Heimholung der von Gott abgeschiedenen Menschen zurück in das „Reich meines Vaters“ (Mt 26,29), zu „meinem Vater und zu eurem Vater“ (Joh 20,17) – also in die neuen Familienverhältnisse, in die Gottesfamilie, die zugleich in Maria, dem „Urbild“ und „Typus“ der Kirche (Lumen gentium 63,65), ihre Mutter haben.
Das heißt: Der „neue Bund“ als Vollendung aller vorangegangenen Bundesschlüsse Gottes mit seinem Volk, ereignet sich unter vorausgehender, primärer, freier Mitwirkung derjenigen, in der Gott selbst Wohnung genommen hat. Sie ist die „Braut“ des Bräutigams schlechthin, was Johannes der Täufer im Evangelium deutlich macht: „Ich bin nicht der Christus, sondern nur vor ihm her gesandt. Wer die Braut hat, ist der Bräutigams.“ (Joh 3,29) Und sie ist zugleich diejenige, die im Geburtsprozess des Erlösers zunächst physisch und buchstäblich „Leib Christi“ ist, denn sie gibt ihm seinen menschlichen und männlichen Leib. Aber als solche ist sie eben auch Mutter des „mystischen Leibes Christi“, der dir Kirche insgesamt ist. Sie ist damit geistlich zugleich Braut des Bräutigams und die neue „Mutter aller Lebendigen“ (Gen 3,20), also Mutter derjenigen, die in den Leib Christi hineingenommen und aus ihm „neu geboren“ werden.
Wir sehen an dieser Stelle wie zwei Dinge deutlich werden: Es gibt in dem, was der Neue Bund, das Neue Testament ist, einen tiefen Zusammenhang zwischen der leiblichen Dimension der Menschwerdung Gottes in einer Frau und durch eine Frau und der geistlichen Dimension der Neugeburt des erlösungsbedürftigen Menschen, hier des Lieblingsjüngers, aus der bleibenden Verbundenheit des Erlösers mit eben dieser Frau – als Typos und Mutter der Kirche! In jeder Eucharistie feiern wir aber das „Hochzeitsmahl“ des Lammes, das heißt die Vergegenwärtigung der Kreuzeshingabe Jesu an seine Kirche und zugleich die Vorwegnahme der endgültigen Vereinigung der Erlösten mit Gott und seiner Kirche in der Ewigkeit. Beide: Jesus und Maria, sind mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen – als Mann und als Frau. Daher spielt notwendig auch in der Ordnung der Erlösung dieses Zueinander eine bleibende Rolle, wie das Konzil im Sinne der gesamten Tradition bestätigt.
Und um noch einmal auf den Zusammenhang von rechtem Kult und rechter sittlicher Ordnung zu verweisen, noch eine schöne Episode kurz erklärt: Im vierten Kapitel des Johannes-Evangeliums begegnet Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen. Hier wird ein biblisches Motiv aus der Väterzeit aufgenommen: Isaak, Jakob und Mose haben ihre Frauen durch Begegnungen an Brunnen gefunden. Samaria steht für das abtrünnige Nordreich, das deshalb ebenfalls in den prophetischen Texten des Alten Bundes als Dirne bezeichnet wird, die ihrem Bundespartner untreu geworden ist (vgl. etwa Jer 3,6-10). Sie beten Gott auf dem Garizim an – in verkehrtem Kult also. Jesus trifft also eine Repräsentantin dieses untreuen Volkes am Brunnen. Einen Typos der untreuen Braut also, eine Frau, die hier ebenfalls keinen Namen hat. Sie kommt zu einer unüblichen Zeit, in der Mittagshitze, nicht in der Morgen- oder Abendkühle – vermutlich aus Scham über ihre Lebensverhältnisse, wie ihre Geschichte gleich zeigen wird, um möglichst wenige andere Menschen zu treffen. Jesus beginnt das Gespräch mit ihr über Durst und Wasser und das lebendige Wasser. Und sie begreift nach und nach, dass da ein sehr besonderer Mann mit ihr spricht, noch dazu ein Jude. Das Gespräch läuft in seinem Höhepunkt auf die Selbstoffenbarung Jesu als Messias zu (Joh 4,26), wenn er sagen wird: „Ich bin es, ich der mit dir spricht.“ Davor braucht es aber für die Frau Klärungen oder wenn man so will, eine Bekehrung. Denn um Jesus wirklich zu erkennen, benötigt sie den Heiligen Geist, nach dem sie mit der Frage nach dem „Wasser“ verlangt, das keinen Durst mehr macht. Das Wasser ist nämlich im vierten Evangelium ein Bild für den Heiligen Geist. Diesen kann aber Jesus offenbar erst dann mitteilen, wenn sie ihr Bekenntnis zu ihrem sittlichen Leben abgelegt hat, um dann „in der Wahrheit“ zu sein. Denn gleich darauf wird Jesus sagen, dass die „wahren Beter“ den Vater „im Geist und in der Wahrheit“ (Joh 4, 23) anbeten werden“. Jesus hilft also der Samariterin mit großer Behutsamkeit in ihr Bekenntnis, indem er sie zwar einerseits einer Lüge überführt, aber die Überführung so gestaltet, dass für ihn darin auch noch etwas von der Wahrheit aufleuchtet. Er sagt: „Du hast richtig gesagt: Ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt.“ (Joh 4, 17-18) Was darin für unseren Zusammenhang von Bedeutung ist: Jetzt, durch die Offenlegung der Wahrheit ihrer sittlichen Verhältnisse vor ihm, ist die Frau offenbar bereit für die tiefere Erkenntnis Jesu, nämlich „im Geist und in der Wahrheit“, wie es heißt. Und sie bezeugt dies sogleich, indem sie ihren Krug mit realem Wasser stehen lässt, aber erfüllt vom Wasser des Geistes in die Stadt läuft und Zeugnis davon gibt, was ihr passiert ist. Später im selben Evangelium wird Jesus sagen: „Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben“ (Joh 7,37-39).
Diese Perikope führt uns noch einmal eindrücklich die These vor Augen, die ich deutlich machen will: Jesus ist der Bräutigam, der will, dass sich seine Braut reinigt und bekehrt, um den neuen Bund mit ihr endgültig vollenden zu können. Die Anbetung „im Geist und in der Wahrheit“, also der rechte Kult, steht auch hier wieder in einem tiefen Zusammenhang mit der rechten sittlichen Ordnung im Verhältnis der Geschlechter zueinander. Die Frau ist erst nach ihrer Überführung und ihrem Bekenntnis fähig, tiefer zu verstehen – und sich mit dem Geist begaben zu lassen. Jesus tut hier an einer exemplarischen und zugleich typologisch relevanten Einzelnen etwas, was er im Augenblick der „Erhöhung“ am Kreuz letztlich für alle tut. Er zieht sie an sich. „Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen“ (Joh 12,32), sagt er im Blick auf seinen Kreuzestod, bei dem er dann „den Geist“ übergeben wird. Wer sich von Jesus und seinem Geist wirklich anziehen – und damit auch „überführen“ (Joh 16,8) lässt, wird von diesem Geist erfüllt und neu geboren werden. Bruder Jesu, Kind des Vaters und Kind der Braut.
Paulus sieht diesen Zusammenhang wohl auch, wenn er als Ziel seiner Verkündigung den Korinthern beschreibt: „Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen.“ (2 Kor 11,2) Gleichzeitig fürchtet er aber folgendes: „Wie die Schlange einst durch ihre Falschheit Eva täuschte, könntet auch ihr in euren Gedanken von der aufrichtigen und reinen Hingabe an Christus abkommen“ (2 Kor 11,3). Das letzte Buch der Schrift, die Offenbarung des Johannes, schließt schließlich mit einem Ruf der Braut an den Bräutigam, er möge endlich kommen: „Maranatha“ (Offb 22,20) .
So zeigt sich an all diesen Beispielen, wie die Kategorie des Bundes die zentrale und die gesamte Heilige Schrift umgreifende Kategorie ist – und wie diese Kategorie immer neu und in vielen Varianten am tiefsten im Bild der Hochzeit von Mann und Frau ihren Ausdruck findet. Zweitens ist deutlich geworden, wie es fortwährend ein intensives Wechselverhältnis gibt zwischen der sittlichen Ordnung im Blick auf das konkrete Leben von Ehe im Bundesvolk einerseits und der rechten Gottesverehrung andererseits. Oder umgekehrt: Sittliche Untreue im Bundesvolk bzw. bei dessen führenden Protagonisten führt zur Korruption des Kultes, zur Verehrung von Götzen – und damit zum Bruch des Gottesverhältnisses. Deshalb ist Jesus als der Bräutigam einerseits der Urheber des neuen und ewigen Bundes – und zugleich führt er das eheliche Verhältnis von Mann und Frau in den „Anfang“ zurück und damit in seine ursprüngliche Bedeutung in der Schöpfungs- und in der Heilsordnung (Mt 19,4-49)
-
Die Menschwerdung und die absichtslose Liebe
Ein wesentlicher Aspekt von „Erlösung“ im gläubigen Sinn bedeutet: Wir werden als Menschen hineingenommen in die neue Gottesfamilie. Wir lernen durch die Kraft des Geistes in unserem eigenen Herzen zu Gott Vater (Abba, Gal 4,6) zu sagen und es von Herzen zu meinen. Wir lernen im Geist Jesus als unseren Bruder Joh 20,17: „zu meinem Vater und zu eurem Vater“) und unseren Herrn zu bekennen (1 Kor 12,3). Und wir lernen, dass wir in dieser Familie auch eine Mutter haben – die Mutter derer, die Jesus lieben und Zeugnis für ihn geben. Biblisch wird das in der genannten Johannes-Stelle deutlich, in der der Jünger, den Jesus liebte, vom Kreuz herab Maria zur Mutter bekommt. Ebenso in der Offenbarung des Johannes, wo erzählt wird, dass der Drache jene Frau verfolgt, die den Weltenherrscher geboren hat (Offb 12,5). Aber der Drache verfolgt auch „ihre Nachkommen“, wie es heißt, das sind jene, „die am Zeugnis für Jesus festhalten“ (Offb 12,7) Deshalb ist sie, wie es im Konzil formuliert worden ist: Unser alle Mutter in der Ordnung der Gnade (LG 61).
Wenn also Erlösung bedeutet in eine gottmenschliche Familie hinein adoptiert werden, dann ist das eine Familie, die sich notwendig durch die Qualität ihrer Beziehungen auszeichnet. Daher ist auch das von Jesus angekündigte „Reich Gottes“ in einem tiefen Sinn das Reich der heilen und geheilten Beziehungen. Und das wiederum bedeutet: Es regiert die absichtslose Liebe; eine Liebe, die sich aus dem dreifaltigen Gott speist und die den Geschöpfen, besonders den Menschen hilft, einander in absichtsloser Liebe zu begegnen. Eine Liebe, die nicht besitzergreifend ist, die nicht ihren eigenen Vorteil sucht. Eine Liebe, die den anderen als anderen meint und nicht insgeheim doch noch subtil egoistisch ist. Und wenn Erlösung auch darauf hinzielt, den Menschen zu dieser Liebe zu befähigen, damit er sich immer mehr als Mitglied der Gottesfamilie erweist, dann steht diese Liebe auch im Ursprung des Erlösungsgeschehens, nämlich in der Menschwerdung Gottes. Gott will im Menschen ankommen und durch den Menschen geboren werden. Er erwählt sich dazu in Maria einen Menschen, die ihr „Ja“ (Lk 1,38) zum Kommen Gottes in und durch sie selbst in lauterster Absicht sagen kann; ohne Hintergedanken, ohne den Blick auf den eigenen Vorteil, ohne innere Abwehrmechanismen. Sie ist als Frau der heile Anfang der erneuerten Schöpfung. Nie hatte ein Geschöpf eine tiefere Beziehung zum allmächtigen Gott als sie. Gott räumt sich in Maria mitten in einer verwundeten und erlösungsbedürftigen Schöpfung gewissermaßen einen heilen Ort, eine heile, ungebrochene Person aus, in der er „Herr“ ist. Sie ist als der biblisch oft genannte „heilige Rest“ Israels (vgl. Jes 4,3) in Person – und zugleich der Anfang des unerwarteten und unerhörten Neuen.
Gerade die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes, macht also deutlich, dass das Verhältnis der Geschlechter zueinander eingezeichnet ist in das Geheimnis von Schöpfung und Erlösung. Jesus wird Gott durchgehend seinen „Vater“ nennen, jene schöpferische, personale Macht und zugleich überfließende Liebe, aus der alles entstanden ist, was ist. Aber diese überfließende Liebe Gottes lässt aus sich zugleich Geschöpfe hervorgehen, denen sie sich im Hervorbringen zugleich übereignet, damit sie dieses Leben ihrerseits selbst hervorbringen und aus ihm leben. Jeder Mensch empfängt Leben, Lebenskraft – aber er bringt sie zugleich selbst hervor, indem er sich als Mensch vollzieht, indem er lebt.
Ein Beispiel, das das verdeutlichen kann: Stellen Sie sich ein Orchester vor, das den Namen Mozart-Orchester trägt. Und stellen Sie sich vor, das Orchester wird eben nur dann es selbst, wird nur dann lebendig, wenn es Mozartstücke spielt. Diese Musik, diese Mozartstücke, sind von seinem Urheber Mozart schon der Welt gegeben, sie sind schon da. Aber das Mozart-Orchester geht als solches in gewisser Weise aus der Existenz dieser Stücke hervor. Und zwar in der Weise, dass es erst dann es selbst wird, wenn es auch Mozartstücke spielt. Und nicht nur das Orchester, auch jeder einzelne Musiker kommt im Orchester zu sich selbst, zu seiner Bestimmung, wenn er auf je seine Weise, mit seinem Instrument und seinen Möglichkeiten mitspielt und Teil des Ganzen wird. Das heißt: Das, was dem Orchester seine Existenz schenkt, ist zugleich das, was das Orchester selbst hervorbringt. Die Philosophie spricht hier vom „Sein“, die christliche Philosophie spricht vom „Sein als Liebe“. Alles ist aus Liebe erschaffen, alles Lebendige lebt, weil der liebende Gott will, dass es lebt. Und zugleich werden die Geschöpfe erst wirklich lebendig, wenn sie selbst ihr Leben leben. Wenn sie es also zugleich empfangen und hervorbringen. Für den Menschen bedeutet das: Wenn er aus Liebe geschaffen ist, lebt er sein Leben dann am tiefsten, wenn er selbst Liebe lebt und Liebe hervorbringt.
In theologischer Sprache gesprochen heißt das: Der Schöpfer schenkt seinem Geschöpf die Gabe, selbst schöpferisch zu sein: „Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich“, sagt Gott im Buch Genesis (1,26). Ist nun Maria der von Gott erwählte „Ort“ des Beginns der neuen Schöpfung, dann vollzieht sich hier in unfasslicher Weise dieses Geheimnis des Seins als Liebe: Das Geschöpf kann dasselbe tun, was der Vater tut – nämlich den Sohn der Welt geben. Weil Gottes Schöpfung aus Liebe geschieht, ist auch dieser Akt seiner Selbstmitteilung, seiner väterlichen Zeugungsmacht zugleich Ermöglichung für das Geschöpf, Gott selbst hervorzubringen und der Welt mitzuteilen. Sie ist Gottesgebärerin (Theotokos). Aus meiner Sicht verdeutlicht sich auch an diesem Geschehen, warum sowohl die Schöpfung, die ganze Natur, wie auch die Kirche als neue Schöpfung stets mit weiblichen und mütterlichen Attributen bezeichnet werden. Mutter Natur, Mutter Erde, Mutter aller Lebenden, Mutter Kirche, biblisch auch Braut des Lammes, Tochter Zion, himmlische Frau.
Dabei ist gerade in der christlichen Erfahrung deutlich, dass das Hervorbringen der Schöpfung zwar zunächst väterlich-männlich konnotiert ist, als überfließende, zeugende und zugleich sich verschenkende Liebesentäußerung. Während die Schöpfung selbst als weiblich konnotiert diesen Schöpfungsakt als Zeugungsakt aufnimmt und zugleich gebiert und hervorbringt. Wenn wir damit aber die Schöpfung so als aus dem Liebesakt Gottes kommend deuten, kann es gerade nicht bedeuten, dass Zeugung auf der einen und Empfängnis auf der anderen Seite lediglich im Aktiv-Passiv-Schema gesehen werden können, mit der klaren Zuordnung: Mann aktiv, Frau passiv. Und damit womöglich auch zur Rechtfertigung eines patriarchalen Macht-Ohnmacht-Szenarios verwendet werden können. Ich möchte noch einmal erinnern, was ich zuvor gesagt hatte, nämlich dass das Macht-Thema erst als Folge des Sündenfalls ins Geschlechterverhältnis eintritt (vgl. Gen 3,16).
Vielmehr ist in dieser Sicht der schöpferische, der sich als Liebe verströmende und deshalb zunächst männlich konnotierte Gott derjenige, der sich im Akt der schöpferischen Liebe selbst zurücknimmt, der sich nicht gewaltsam durchsetzt, sondern im Schenken so sehr Freigabe ist und Raum der Selbstentfaltung gibt, dass er dann selbst zugleich Empfangender dieses Anderen, dieses Freigesetzten wird. Und umgekehrt: Das empfangende Geschöpf wird im Empfangen ermächtigt, selbst hervorbringend, selbst mitzeugend zu sein. Im Grunde wird hier sowohl im Schöpfungsakt, wie auch im Akt der erlösenden Inkarnation deutlich, dass sich Geben und Empfangen füreinander verwenden, dass männlich und weiblich im liebenden Miteinander zwar nicht einfach austauschbar werden, aber sich zutiefst aufeinander beziehen und ineinander finden: Der Gebende wird zugleich mit seinem liebenden Geben zum Empfangenden – und der Empfangende wird zum liebenden Geber. Auch der gekreuzigte Herr wird diese Wahrheit in letzter Radikalität mit seinem ganzen Leben ausbuchstabieren: Aus der sich selbst verströmenden Hingabe seines Lebens, erwächst ihm die Kirche als Braut, empfängt er sie als die ihm unauflöslich Verbundene. Und umgekehrt: Sie, die Frau, die Kirche empfängt sein Leben – um aus ihm zu leben – und es zugleich der Welt zu geben.
Meine These ist daher: Erst dann, wenn sowohl die schöpferische wie die erlösende Liebe Gottes nicht mehr tief genug aus ihrer radikalen Absichtslosigkeit gesehen wird, wenn sie etwa durch Streben nach Macht oder Machterhalt verdunkelt wird, wird der weltliche Kampf der Geschlechter auch zum Kampf um die Geschlechterrollen in der Kirche. Und zwar von beiden Seiten: Der männliche Klerus hält an seiner Macht fest, ohne sich liebend verschenken und darin auch empfangend werden zu wollen. Das empfangende, klein gehaltene Gottesvolk will nichts mehr empfangen, sondern eher die ihrer Macht berauben, die krampfhaft daran festhalten. Das ist eine Karikatur von Kirche, die wir aber allzu oft real erleben.
Freilich muss ich dazu sagen: Eine solche Darstellung impliziert trotzdem nicht die naive Vorstellung, dass Gott nur Mann und die Schöpfung nur Frau wäre. Vielmehr ist in Gott alles in allem und ist Gott selbst alles in allem. Gott ist damit selbstverständlich immer auch jenseits jeder geschlechtlichen Dualität. Und mitten in der Schöpfung differenziert sich eben diese zunächst eher mütterlich erfahrene Schöpfung in den höherentwickelten Geschöpfen aus in männlich und weiblich. Und im dreieinigen Lebensvollzug des einen Gottes finden sich zugleich alle heilen Verhältnisse von Geben und Empfangen, Lieben und Geliebt-sein. Und wenn der Vater der Ursprung von allem ist – und nur deshalb „größer“ als Jesus (Joh 14,28), dann ist der Sohn aus diesem „gezeugt werden“ der Empfangende und wäre damit innertrinitarisch sogar eher weiblich konnotiert. Freilich so, dass der Sohn die ganze Gottheit empfängt und selbst lebt und ist – und daher zugleich sagen kann: „Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30). Denn auch der Vater empfängt dann sein Vater-sein erst vom Sohn, der sich ihm in der Empfängnis der Gottheit radikal zurück-gibt – in der Liebe, die der Geist selbst ist.
Aber beide, Vater und Sohn, haben nun im Bezug auf die Schöpfung und die Erlösung hin ein Gegenüber, das primär den Schöpfungsakt empfangend und dann zugleich hervorbringend ist, eben die ursprüngliche Schöpfung der Welt beim Vater und die Kirche als neue Schöpfung und Braut beim Sohn. Und deshalb gehört nach meiner Auffassung das Geheimnis von Mann und Frau mitten in das Geheimnis von Schöpfung und Erlösung hinein. Mehr noch es ist sogar dessen innere Signatur, also eine entscheidende Lesehilfe für die ganze Schrift und für alles, was unter dem Stichwort „Bund“ steht. Und zwar von den ersten Seiten der Schrift, von Schöpfungserzählung und Sündenfall, über die immer neue Suche Gottes nach seinen Bundespartnern im Alten Bund, über das Kommen Jesu, des endgültigen Bräutigams des neuen Bundes bis hin zum Buch Offenbarung und den allerletzten Versen der Schrift, wo der „Geist und die Braut“ (Offb 22,17) den Bräutigam rufen: „Komm, Herr Jesus“ (Offb 22,20).
-
Wort und Antwort
Die Kirche bekennt mit dem Johannes-Evangelisten den Erlöser als Logos, als Wort, in dem der Vatergott sich vollkommen ausspricht; in dem er gewissermaßen alles sagt, was er aus Liebe zu sagen hat. Der Sohn sagt in radikaler Hingabe letztlich am Kreuz genau dann alles, wenn er verstummt: „Es ist vollbracht“ (Joh 19,30). Die sich sterbend übereignende Liebe sagt alles. Wenn wir nun fragen, wie Jesus als lebendiges Wort in unsere Welt kommen will, dann sehen wir an den markantesten Punkten unserer Begegnung mit ihm, dass er als Gabe kommt – in der ungeheuerlichen, unfasslichen Einheit von Fülle und Nichts, von Reichtum und Armut der Liebe. Das kleine Kind in der Krippe von Weihnachten, das noch kein Wort sprechen kann, feiern wir an eben diesem Weihnachtsfest als das ewige Wort des Vaters, als Erlöser von allem. Der große Wundertäter, den die Menschen in ihre Gewalt bringen und zum mächtigen König machen wollen, lässt sich wehrlos hinschlachten als ohnmächtiger König der völlig anderen Art. Der gekreuzigte, gefolterte und getötete Messias am Kreuz ist nach dem Zeugnis des Johannes-Evangelisten der höchste Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Das eucharistische Brot, das wie ein kleines Stück Nichts im Gottesdienst von uns empfangen wird, ist die wirkliche Gegenwart des Erlösers der Welt. Gott kommt in Jesus als Gabe in dieser Liebesgestalt der Einheit von Allem und Nichts. Denn „so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab.“ (Joh 3,16)
Wie um alles in der Welt, so können wir uns fragen, wie kann ein sündiger Mensch diese Gabe, diese Form der liebenden und zugleich frei gebenden Hingabe so empfangen, dass sie wirklich ankommt? Dass sie so angenommen wird, dass sie im Ort ihrer Annahme trotzdem sie selbst bleibt? Und sich auswirken kann – und nicht entstellt oder verkannt oder abgewiesen wird? Wir kennen das doch von anderen Dingen, die uns als Geschenk angetragen werden: Manchmal können wir damit wenig anfangen – und weisen es zurück. Oder wir beachten es im Annehmen gar nicht, weil wir es in der Absicht des Gebenden nicht erkennen, oder in seiner eigentlichen Bedeutung. Oder es erscheint uns viel zu groß und wir sagen: Das kann ich beim besten Willen nicht annehmen. Oder wir fühlen uns sofort verpflichtet, etwas zurückzugeben oder wiedergutzumachen. Oder wir verdächtigen den Geber, dass er uns durch die Gabe doch nur kaufen oder manipulieren will. Oder ähnliches mehr. So komplex ist das Geschehen von Geben und Empfangen, dass gerade uns sündige Menschen die Ankunft des Erlösers als absolute Liebesgabe gänzlich überfordern würde! Wer könnte diese Gabe annehmen? Wer könnte dieses Liebeswort Gottes angemessen beantworten? Durch wen könnte Gott so in die Welt kommen, wie er kommen will? Als Liebesgabe?
Thomas von Aquin sagt, dass Maria im Augenblick ihres Ja-Wortes dieses Ja stellvertretend für die gesamte Menschheit spricht, für die gesamte menschliche Natur, wie es wörtlich heißt (vgl. Sth III,30,1). Sie ist die Person, die als einzige von Gott vorbereitet und befähigt wurde, diese Antwort zu geben, ihr ganzes Person-sein zur Verfügung zu stellen und im Empfangen des lebendigen Gotteswortes nicht nur eine verbale Zustimmung zu geben, sondern in dieser Zustimmung sich selbst und ihr ganzes Menschsein zur Verfügung zu stellen. Sie ist so sehr geschaffene, lebendige Antwort, wie der Erlöser lebendiges Wort ist. In diesem „fiat“ Mariens, in ihrer Zusage: „Mir geschehe nach deinem Wort“ (Lk 1,3), wird also die ein für alle Mal erfolgte Antwort eines Menschen gesprochen, die dieser Form des Kommens Gottes in die Welt die Tür öffnet und geöffnet hat: Endgültiger Bund, endgültige Hochzeit von Gott und seiner Schöpfung – mitten in dieser verwundeten Schöpfung. So wie sein Kommen, sein Ja zu uns unwiderruflich ist – so wird ihre Antwort unwiderruflich eine bleibende sein. Ihre innerste Verbundenheit mit dem Erlöser beschränkt sich nicht auf den zeitlichen Moment ihres Ja-sagens, sondern darin drückt sich fortan ein Ineinander-Wohnen Gottes mit seiner heilen Schöpfung aus, das auf ewig bleiben wird. Hier ist der Anfang des „neuen und ewigen Bundes“ (wie wir im Hochgebet der Messe formulieren), unlöslich mit diesem existenziellen, antwortenden Ja Mariens verbunden. Diese bleibende Verbundenheit führt sie am Ende des irdischen Lebens Jesu bis unter das Kreuz, wo sich die Prophetie des alten Simeons vollständig bewahrheiten wird: „Dir wird ein Schwert durch die Seele gehen“ (Lk 2,35). Dort, wo das Leiden und Sterben des Sohnes den Geist freisetzt (vgl. Joh 7,39: Die Gabe des Geistes durch Jesu Kreuzigung/Verherrlichung), ist auch sie mit ihrem Leiden, mit durchbohrter Seele dabei – und wird später als Urgestalt der Kirche denen helfen zum Sohn zu gelangen, die zu ihm wollen, die seinen Geist empfangen wollen. Und so vollzieht sich in der Folge Erlösung am einzelnen Menschen durch die Hineinnahme jedes Menschen in diesen Bund, in die Verbundenheit des Erlösers mit seiner Braut; mit seiner Kirche, damit auch der einzelne Mensch selbst Kirche werde. Auch hier wird wieder deutlich, wie der biologische Leib Christi, der „von einer Frau“ (Gal 4,4) genährt und geboren wurde, überstiegen wird in das Geheimnis der Kirche als mystischer Leib Christi, in die auch wieder dieselbe Frau unter dem Kreuz hineingenommen ist: Mutter „in der Ordnung der Gnade“ (LG 61). Dort, wo der Herr im Abendmahlssaal „mein Leib für euch“ gesagt hatte, dort hatte er es schon vorher in der Inkarnation zu Maria gesagt und vollzogen: Sein Leib für sie – und zugleich aus ihr. Und auf Golgotha wird sie in der Ikonographie der Kirche dargestellt als die Pietá, die dieses geheimnisvolle Geschehen bis zum letzten Blutstropfen Jesu mitvollzieht. Sein Leib wird ihr in den Schoß gelegt – und er sagt damit wieder: „Mein Leib für dich“. Es ist die Hochzeitsgabe des in dieser Welt Sterbenden an seine Braut – auf dass seine Braut und mit ihr ihre vielen Nachkommen erhoben werden zur neuen Schöpfung und den Weg nach Hause finden, ins Vaterhaus.
-
Die Weite des Herzens
Wir sehen, wie sich aus solchen Überlegungen eine Antwort findet auf die Frage: Wer ist die Kirche? Im Innersten ist es Maria. Sie ist das bleibende Herz, die bleibende Antwort, das geschaffene, antwortende „fiat“, das ein für allemal bleibt. Diese Antwort kommt aus dem Herzen dieser Frau. Und das Herz ist biblisch die Mitte jeder Person, Ort der wesentlichen Entscheidungen, Sitz des Gewissens, Sitz der prägenden Haltungen, in denen ich Gott, der Welt und mir selbst begegne. Das Herz ist letztlich jene Instanz, „in“ der und „durch“ die entschieden wird, wer wir letztlich sind. „Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz“ (1 Sam 16,7) ist die biblische Überzeugung. Daher erklärt es der Autor des Buches der Sprichwörter zum eigentlichen Kampfplatz menschlichen Strebens und gibt daher den wichtigen Rat: „Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus.“ (Spr 4,23).
Das Herz ist zugleich innerer Beziehungsraum. Ich kann andere in mir Raum geben, sie „in mein Herz“ hineinlassen, ihnen einen „Platz in meinem Herzen“ geben. Das heißt: Je tiefer ein Mensch einen anderen in sich einlässt, desto tiefer wird dieser andere in der Lage sein, einen Herzensoffenen zu berühren, zu betreffen oder auch zu verletzen. Herzensoffenheit schenkt anderen Heimat. „Im Herzen“ eins wohlwollenden anderen kann ich tiefer lernen, ich selbst zu werden, in eine neue Freiheit finden. Wir sagen zu uns liebenden Menschen: „Bei dir kann ich sein, wie ich bin.“ Gelingende Selbstwerdung geschieht deshalb immer auch durch liebende Zuwendung durch andere, durch offene Herzen anderer für mich. Ein Beispiel dazu: Mein Ordensvater Don Bosco etwa hatte ein überaus weites Herz für Jugendliche aus armen Verhältnissen. Wenn junge Menschen in seine Einrichtung gingen, sagten sie eben nicht: Ich gehe in das Haus XY, wo man Freizeit verbringen kann. Sie sagten: Ich gehe zu Don Bosco. Warum? Weil er mit der Weite seines Herzens diese Einrichtung so durchwaltet hat, dass jeder Jugendliche den Eindruck gewinnen konnte: Ich bin bei Don Bosco zuhause. Ich habe Platz „in seinem Herzen“.
Biblisch hat das Herz allerdings auch seine großen Schwächen: Es ist eben nicht nur die Personmitte mit ihren guten Qualitäten, sondern eben auch Ort der Gebrochenheit, der Sünde. „Verflucht“ nennt der Prophet Jeremia den Menschen, „dessen Herz sich abwendet vom Herrn“ (Jer 17,5). Und weil die Gefahr dieser Abwendung grundsätzlich bei allen Menschen besteht, liegt dieser Fluch geheimnisvoll über allen. Denn: Das Herz des Menschen ist „arglistig ohnegleichen und unverbesserlich“ (Jet 17,9). Und auch Jesus sieht, wie im Grunde alle schlechten Eigenschaften eines Menschen aus dieser inneren Mitte kommen: „Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft“ (Mk 7,21f).
Ist das menschliche Herz aber durch Verletzungen und Enttäuschungen, durch Lüge anderer oder eigene Egozentrik in sich gekrümmt, dann neigt es als „Beziehungsorgan“ dazu, andere gerade nicht freizugeben und wachsen zu lassen, sondern vielmehr in problematischen Beziehungen zu halten oder zu manipulieren. Wenn ein Mensch etwa nie die Erfahrung machen durfte, sicher in Beziehungen getragen zu sein, etwa als Kind, dann wird er in späteren Beziehungen mit einiger Wahrscheinlichkeit dazu neigen, stärker besitzergreifend zu werden, den anderen Menschen an sich klammern zu wollen. Dann ist das Herz nur dem Anschein nach ein Raum gebendes, tatsächlich aber eines, das sich in der Beziehung selbst absichert – aus Angst davor, ohne die Beziehung wieder den erfahrenen Halt zu verlieren. Besitzergreifende Herzen sind daher auch nicht selten manipulativ oder neigen zu emotionaler Erpressung. Daher ist eine der großen Prophetien im Alten Bund diejenige eines „neuen Herzens“, die sich etwa im Ezechiel-Buch zweimal wiederholt, wenn Gott sagt: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch“ (Ez 36,26, vgl. 11,19).
Jesus selbst ist derjenige, der das heile, das gottmenschliche Herz schlechthin hat – und damit das weiteste von allen. Hans Urs von Balthasar sagt von Jesus selbst, dieser sei „das Herz der Welt“ – das in seiner schöpferischen Kraft und Liebesfähigkeit alle Wunden und Sünden der Welt in sich hat eingehen lassen, um sie von innen her zu verwandeln.
Und in dieser Sprache ist auch Maria notwendig die Person, die als geschaffene das neue und daher weiteste Herz von allen hat, weil ungebrochen, ohne Eindrehung in sich selbst. Sie ist als geschaffene Person die liebesfähigste, die je gelebt hat. In ihr selbst nimmt Gott in radikaler Weise Wohnung und daher ist auch in diesem Herzen so große Weite und Platz für so viele Verwundete und Geschlagene, für uns Sünderinnen und Sünder.
Wenn wir nun für das Christwerden noch einmal die Familienanalogie bemühen, dann bin ich überzeugt, dass das Ineinander des gottmenschlichen Herzens Jesu und des heilen menschlichen Herzens Mariens den geistlichen Raum eröffnet, der im Innersten Kirche selbst ist. Wie für ein Kind, das aus der Liebe zwischen Papa und Mama hervorgeht und sich in diesem Beziehungsraum bewegt.
Das sich verschenkende Ja Jesu von oben und das ihm antwortende geschöpfliche Ja von unten eröffnen einen Raum, in dem Kirche Gegenwart Christi, Leib Christi ist in Haupt und Gliedern, Braut und Bräutigam. Hier ereignet sich sakramentale, reale Präsenz Jesu. Die genannten Bilder der Schrift für das Geheimnis der Kirche gehen ineinander über, haben aber ihr Fundament im konkreten Geschehen von Menschwerdung und Erlösung, von Nazareth und Betlehem über Golgotha bis zum Pfingstereignis – zwischen dem dreifaltigen Gott und der Jungfrau und Mutter, zwischen Christus und Maria.
Durch die Taufe wird der Christ in diesen inneren, personal geprägten „Raum“ hinein genommen, in dieses raumgebende Ineinander der heilen Schöpfung und ihres Erlösers und ihrer offenen Herzen. Taufe ist Aufgenommen-werden in diese Gemeinschaft und zugleich das Neugeboren-werden aus ihr. Wir werden existenziell neu geboren in dem Maß, in dem wir immer mehr lernen, wie Maria, unser volles, existenzielles, antwortendes Ja zur Liebe und zum Anruf des Erlösers zu sprechen. Und wir lernen es sprechen, indem wir „in die Kirche“ gehen, also in den personal eröffneten Raum, in dem dieses Ja zutiefst immer schon gesprochen ist und bleibend da ist: „Schau nicht auf unsere Sünden, betet der Priester vor der Kommunionspendung, schau auf den Glauben deiner Kirche“. Diese Kirche ist in Person Mariens die Gläubige als Typos der Kirche schlechthin, die Mutter des Glaubens. Und in ihr und mit ihr lernen wir – trotz unserer eigenen Fehler – das Ja zum Herrn, zu seiner Herrschaft in unserem eigenen Inneren immer mehr zu sprechen. Viele von uns haben das schon erfahren: In der Nähe von guten Menschen wird man oftmals selbst ein besserer Mensch. In der inneren Nähe zum Ja Mariens lernen wir – trotz allem, wie wir auch sind – immer mehr Ja zu sagen. Und vollziehen im Lauf eines Lebens immer tiefer den Akt der Neugeburt aus dem Raum der Vermählung des Gottmenschen mit seiner Braut.
-
Teilhabe an klerikaler Macht?
So möchte ich nach dieser langen Rede abschließend sagen: Ich bin überzeugt, dass das Ineinander von Jesus als Bräutigam und Maria als Inbegriff der Braut Kirche eben in dieser Weise in das Geheimnis von Schöpfung und Erlösung hinein gehört. Ich bin überzeugt, dass Getauft-werden auch bedeutet, in der Kirche eine reale, geistliche Mutter und einen wirklichen Vater zu haben, der uns in Jesus sein erlösendes Antlitz gezeigt hat. Ich bin überzeugt, dass in der Eucharistie das Hochzeitsmahl des Lammes, der endgültige Bund, die endgültige Versöhnung von göttlichem Bräutigam und seiner Braut, der Kirche und ihren Kindern, zwischen Gott und Schöpfung im Hl. Geist immer neu vergegenwärtigt wird. Ich bin überzeugt, dass Jesus und Maria auch im Himmel immer noch Mann und Frau sind – und daher auch himmlische Kirche, himmlisches Jerusalem sind mit allen, die sich dorthin haben hineinlieben lassen. Es ist ein himmlisches Jerusalem, in dem fortwährend hochzeitliche Liturgie des Himmels gefeiert wird und alle Erlösten Gott verherrlichen. Ich bin deshalb überzeugt, dass in der Eucharistie unserer Kirche Christus durch einen dazu berufenen Mann sakramental repräsentiert werden muss. Der Priester handelt – wie unsere große Überlieferung sagt – in der Eucharistie „in persona Christi“. Das heißt: Er spricht nicht nur einen alten Text nach, er spielt auch nicht eine Rolle in einem Theaterstück. Sondern in und durch ihn handelt Christus als Bräutigam in der Hingabe seines Leibes. Ich möchte nach allem Gesagten ernsthaft fragen: Wäre es möglich, dass in diesem Verständnis von sakramentaler Gegenwart Jesu eine Frau in der hl. Messe seine hochzeitlichen Wandlungsworte sagt, die da heißen: „Das ist mein Leib für euch!“ Ich glaube nicht. Und wenn Sie nun fragen, warum das dann für unsere evangelischen Geschwister offensichtlich doch möglich ist, dann ist die katholische Antwort: Weil unsere evangelischen Geschwister ein sakramentales Priestertum in unserem Verständnis nicht kennen und weil folglich dort auch die Kirche selbst nicht als Sakrament verstanden wird. Oder umgekehrt: Es ist kein Zufall, dass ein sakramentales Verständnis des priesterlichen und bischöflichen Amtes zutiefst zusammengehört mit einem sakramentalen und deshalb auch marianischen Verständnis von Kirche.
Schließlich ein allerletzter Blick auf die Frage nach der klerikalen Macht. Ich meine zu sehen, dass es immer noch viele, viele Orte in unserer Kirche gibt, in denen ein Priester als Leiter einer Gemeinde sein Leben wirklich aufrichtig und tief aus der Nähe zu Christus lebt und deshalb in der Hingabe an die Menschen. Und fast überall, wo dies der Fall ist, verschwinden häufig die Fragen darüber, wer denn jetzt alles an der klerikalen, männlichen Macht Teilhabe bekommt. Vielmehr geht es dann zuerst um die Frage: Wie können wir uns durch den Dienst der Kirche alle miteinander, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, Priester und Laien heiligen lassen durch das Hochzeitsmahl des Lammes?
Zum Synodalen Weg
Bischof Stefan hat sich bereits in der Vergangenheit mehrmals zum Synodalen Weg geäußert. Eine Stellungnahme zu den einzelnen Bereichen finden Sie hier.

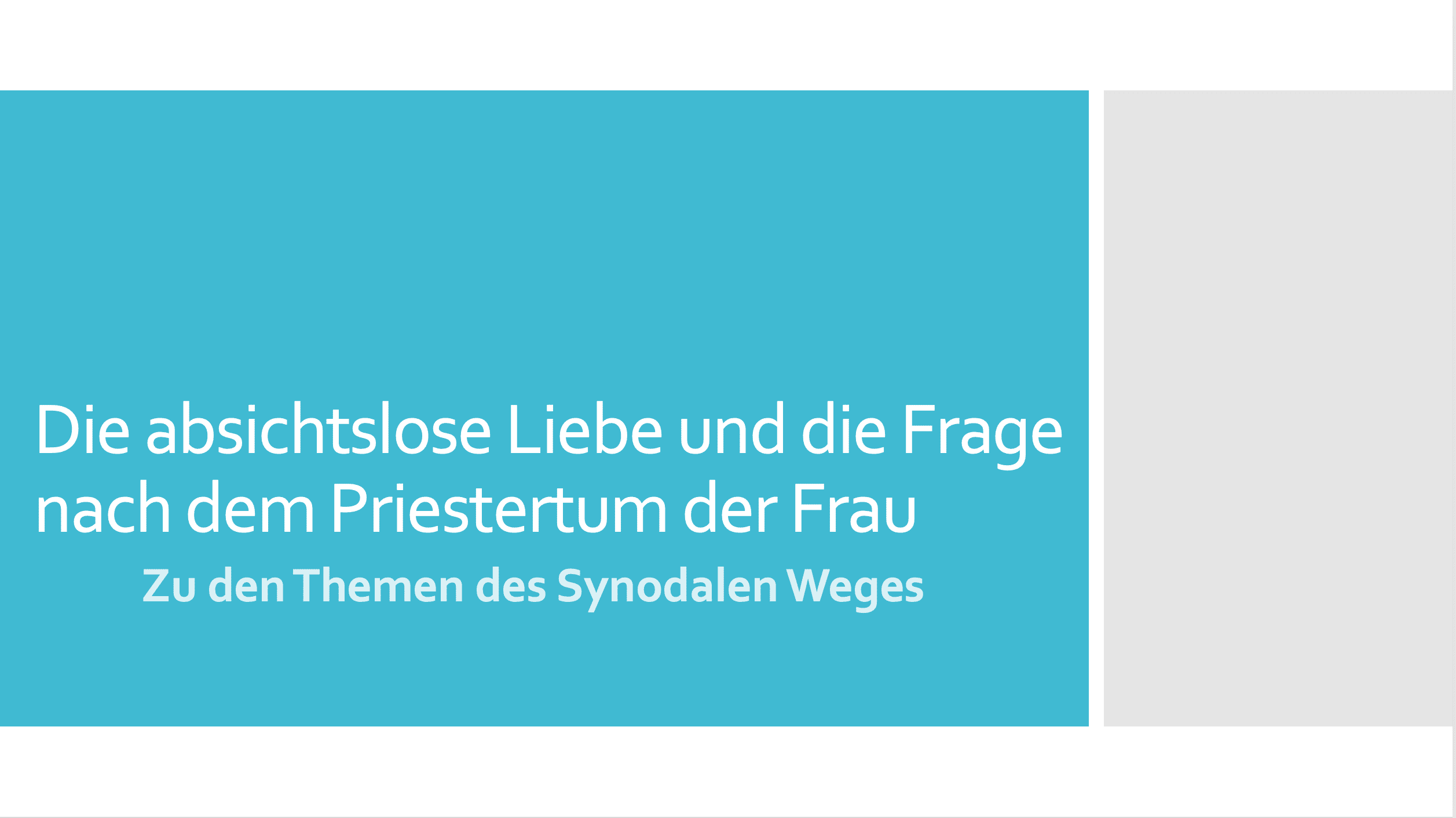

Kommentare
Ich danke Bischof Oster für das Bemühen um Transparenz. Das freilich lädt einmal mehr dazu ein, genau zu hinterfragen, was Bischof Oster sagt. Ich mache das hier aus Platzgründen beispielhaft an einem – zentralen – Ansatz und summarisch zur Braut-Bräutigam-Argumentation:
I.
Zitat: „Nach meiner Einschätzung hat der Papst [Johannes Paul II, Anm,] damals – so wie er die Sache selbst formuliert hat – ein unfehlbare Lehrentscheidung getroffen. Ob sie unfehlbar war, ist theologisch durchaus bei vielen Fachleuten umstritten. Der Papst selbst aber hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er hier unfehlbar sprechen wollte. Denn er hat betont, dass dieser Vorbehalt des Priestertums für berufene Männer 1. von Gott selbst so gewollt sei und daher 2. auch zum so genannten Glaubensgut der Kirche gehöre. Das will sagen: Mit seiner Entscheidung, dass das nun endgültig so zu glauben und zu halten sei, bekräftigt der Papst nicht etwas Neues, sondern etwas, was in der Kirche immer und überall und von allen so geglaubt und gelebt wurde.“
Anmerkung meinerseits: Es sei den Bischof Oster und dem früheren Papst unbenommen, das so zu sehen. Es ist aber niemandem verwehrt, das anders zu sehen. Der Skandal entsteht dadurch, dass Johannes Paul II. andere Menschen an seine Meinung binden wollte. Dazu fehlte ihm aber die Autorität. Autorität wird einem Menschen von seinen Mitmenschen zugebilligt (oder auch nicht). Selbst wenn jemand behauptet, seine Autorität stamme von Gott, können andere Menschen das anders sehen. Insofern hängt Autorität immer an der Zustimmung der Mitmenschen, dass ein Mensch Autorität besitzt.
II.
Zitat: „Das heißt nun aber auch: Selbst die kritischen Theologinnen und Theologen, die anzweifeln, dass der Papst hier unfehlbar gesprochen hat, räumen ein, dass diese Aussage von Johannes Paul II. trotzdem höchstes Gewicht hat – und dass ein Nachfolger nur sehr, sehr schwer daran vorbeikommt, womöglich nur mit der Autorität eines neuen Konzils.“
Anmerkung meinerseits: Bischof Oster behauptet hier eine logische Verbindung. Ich bin der Meinung, diese gibt es gar nicht. Ob auch kritische Theologen den Aussagen „höchstes Gewicht“ einräumen, ist eine empirisch zu überprüfende Aussage. Empirische Belege bringt Bischof Oster aber nicht. Die Aussage ist daher eine unbewiesene Behauptung und in der Argumentation daher nichtig.
III.
„Ich meine, dass kein Nachfolger daran überhaupt vorbeikommt. Das heißt: Man kann zwar darüber diskutieren, ob die angeführten Argumente stark oder schwach, gut oder weniger gut sind, aber an dieser Entscheidung ist aus meiner Sicht nichts mehr zu ändern.“
Es sei Bischof Oster unbenommen, das so zu sehen. Niemand anderer ist daran gebunden. Insofern bringt das nichts in der Argumentation.
IV.
Zitat: „Und wollte man es ändern, kann ich es mir nicht anders vorstellen als unter dem Preis eines Los von Rom oder eines erneuten Schismas in der Kirche. Denn es wird dann neben denen, die gehen, notwendig auch viele geben, die an dem festhalten wollen, was Johannes Paul II. erklärt hat.“
Anmerkung meinerseits: Das mag so sein, aber das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist: Kann die Kirche Frauen zu Priesterinnen weihen? Ob damit ein Teil der Kirchenmitglieder nicht einverstanden ist, ist eine andere Frage.
—
Zur eigentlichen Argumentation in Abschnitt 6 ist dann aus meiner Sicht festzustellen, dass mit der hier angewandten „Argumentation“ auch sagen könnte, dass alle vom Bankrott betroffenen Unternehmer Badesachen tragen müssen.
Wie komme ich dazu, so etwas (nicht zynisch gemeint) zu behaupten?
Bischof Oster argumentiert in der Braut-Bräutigam-Symbolik, wie sie zweifellos oftmalig in biblischen Texten vorkommt. Diese Argumentation auf die Priesterweihe und die Repräsentation Christ auszuweiten, ist aus meiner Sicht aber unzulässig. Denn dass es sich hier um Metaphern handelt, ist für jedermann offensichtlich. Metaphern an sich sind kein Grund, um Argumente daran festzumachen, weil sie immer nur einen Teilbereich der Wirklichkeit umschreiben und in einen anderen Bedeutungszusammenhang bringen. Sie sind nicht die Realität.
Um mein Beispiel von vorhin aufzulösen: Die bekannte Metapher lautet ja, dass insolventen Unternehmern das „Wasser bis zum Hals steht“. Kein vernünftiger Mensch käme freilich auf die Idee, von dieser Metapher eine Sollensaussage zur Bekleidung dieser Unternehmer in Badesachen zu formulieren (siehe oben). Aus dem metaphorischen Bereich leitet Bischof Oster aber (ähnlich wie Prof. Tück, Wien) reale Sollensaussagen ab. Das wäre nur dann zulässig, wenn nachgewiesen worden wäre, dass der beschriebene Bereich mit der beschreibenden Metapher funktional völlig ident wäre. Das sehe ich aber im konkreten Fall beim besten Willen nicht.
Dr. Heinz Niederleitner, Traun (Oberösterreich)
Sehr geehrter Herr Dr. Niederleitner,
lese ich Ihren Kommentar zu den Ausführungen von S.E. Bischof Stefan, so frage ich mich wie Sie generell zum Lehramt der Kirche, der Tradition der Kirche und der Verbindlichkeit der Worte in der Heiligen Schrift stehen. Sie sagen: “ Autorität wird einem Menschen von seinen Mitmenschen zugebilligt (oder auch nicht). Selbst wenn jemand behauptet, seine Autorität stamme von Gott, können andere Menschen das anders sehen. Insofern hängt Autorität immer an der Zustimmung der Mitmenschen, dass ein Mensch Autorität besitzt.“
Wenn es objektive Ordnung, keine allgemein zugebilligte und davon zu befolgende Autorität gäbe, würden wir – beim Ihrem Beispiel zu bleiben – manchen Mitmenschen auch die Vorfahrt im Straßenverkehr nicht „zubilligen“, weil die zuvor die rowdyhafte Fahrweise des Mitmenschen mißbilligen. Es ist ein sehr plakativer und einfacher Vergleich, wenn es um die Autorität der Kirche Christi geht. Aber generell Autorität auf die subjektive Zustimmung des Einzelnen zu reduzieren, bedeutete jegliche gesellschaftliche Ordnung zu verwerfen.
Denken Sie an die vielen Worte Christ selbst: „Ich sage Euch …“. Er sprach mit selbstverständlicher Autorität. Denken Sie an den Dekalog. Moses erhielt die Zehn Gebote, um diese den Menschen als verbindliche Lebensregeln und Leitlinien zu geben, um den Tanz um das Goldene Kalb und die Verwirrung unter den Menschen, wie auch die Zwietracht, durch die Autorität Gottes wieder zu beenden und für die Zukunft einen besseren Weg vorzugeben.
Wie sehen Sie die Apostolische Sukzession, also die Nachfolge der Bischöfe in ununterbrochener Generationenfolge zu den ersten Aposteln? Soll diese Nachfolger nicht in derselben Verantwortung und mit derselben Aufgabe versehen seien, wie es auch die Apostel waren, als Jesu diese aussandte in Seinem Namen, also mit Seiner Autorität, die Frohe Botschaft zu verkünden?
Wir leben in einem Zeitalter, in dem leider oftmals der Versuch unternommen wird, naturgegebene Unterschiede als Belastung und Einschränkung des Individuums zu sehen. Männer müssen alles können und dürfen, was Frauen können und dürfen, und umgekehrt. Mann und Frau ergänzen sich nicht mehr und bilden somit ein schöneres und größeres Ganzes. Nein, im Individualismus, soll jeder in sich selbst die gesuchte Vollkommenheit finden können. Ist aber diese Suche nach Vollkommenheit in sich selbst nicht auf eine Abwendung von Gott und Seinem Wesen und Gedanken der aufeinander zugehenden Liebe?
Warum sollen Kinder dann noch von Eltern durch deren elterlich wohlgemeinte und gut durchdachte Autorität angeleitet werden? Wozu braucht es dann noch Lehrer oder Vorbilder? Wieso nennen wir uns als Christen „Kinder Gottes“, wenn wir die über zwei tausend Jahre gewachsenen und vielfach kontrovers diskutierten Lehrmeinungen der Kirche meinen auf den generellen Prüfstand stellen zu wollen?
S.E. Bischof Stefan hat schlüssig dargestellt, wie vom Beginn der Schöpfung in der Heiligen Schrift, bis zur Person Jesu Christi und der Schlüsselrolle Mariens zwar eine „Diskriminierung“ – im eigentlich originären Sinne des Wortes als „Unterscheidung“, zwischen Mann und Frau, Christus und Maria zu erkennen ist, aber diese Unterscheidung hat doch nichts mit gesellschaftliche Anerkennung oder Wertschätzung eines jeden Mannes oder einer jeden Frau zu tun.
Weshalb dann immer wieder die Diskussion um die Öffnung des Priesteramts für Frauen hochkocht, begreife ich als Frau nicht. Sollen wir in Zukunft von „Hirt:innen“ sprechen, wenn das Evangelium vom „Guten Hirten“ gelesen wird? Soll bei den Worten „Dies ist mein Leib, der für Euch hingegeben wird“ der sarkastisch kritische Zuhörer als Christ sich die Gegenwart Christi dann als geschlechtsloses Geistwesen vorstellen – wie es im 40.Jahrhundert den Grundstreit in der Kirch gab, ob Jesus wirklich Mensch und Mann in Fleisch und Blut oder doch nur die Vision eines geisthaften Gottwesens war?
Wir leben in einer Zeit, in der die menschlichen Bindungen, die Ehe, die Familie als soziale Gestaltungsräume umgedeutet werden, als Lebensabschnittsgemeinschaften, als Liebesbeziehungen geistiger und emotionaler Art, losgelöst vom eigentlichen Schöpfungsgedanken. Mann und Frau sind Pro-Kreatoren, sie nehmen in ihrer Liebe und Vereinigung am liebenden Schöpfungshandeln Gottes Anteil.
Braut und Bräutigam sind somit nicht nur eine Metapher, wie Sie meinen. Im Dekalog heißt es: „Du sollst nicht ehebrechen“. Die Ehe wird als wesentlich hochgehalten. Deshalb die Rede von Braut und Bräutigam und nicht von beliebiger Lustbefriedigung mit dem Nebenprodukt ein Kind zu zeugen. Die Kirche selbst trägt die Frucht von Gottes Leibe und Geist in sich und gibt diese in unserem irdischen Dasein an die irdischen Familien und Generationen weiter.
Wenn durch den Heiligen Geist und von ihm getragen Männer dem Ruf folgen (dürfen), durch Verzicht auf eine irdische Familie, geistlich die Funktion Jesu einzunehmen der Kirche als Gegenüber spirituell Vater seien zu können, wie paßt dann der Wunsch nach der Priesterinnenweihe da ins Bild?
Meine Antwort an Sie hier bitte ich als Anregung zu verstehen und möchte nur darauf verweisen, daß das Verwerfen der Argumente von S.E. Bischof Stefan als „kann er ja sehen wie er will, ich und andere sehen das anders“, den Tod jedes Zusammenwirkens im Endeffekt bewirkt. Kirche kann in Individualismus und Subjektivismus einer Epoche nicht die „Pilgernde Kirche durch die Zeit“ sein, wie diese im Zweiten Vatikanum beschrieben wurde. Der Zeitgeist und die gesellschaftlichen Ansichten ändern sich, manchmal sogar schnell, manchmal durch Gewalt. Aber die Kirche muß Heimat und Halt für alle Generationen bleiben, indem sie an Grundfesten unserer Existenz und gewollten Hinordnung zueinander nicht aus falsch verstandener Geschlechtergerechtigkeit rüttelt. Gerechtigkeit wird heute oftmals mit Gleichmacherei verwechselt. Freiheit alles tun und lassen zu dürfen, wird für viele auch zur Bürde das Leben niemals wirklich auskosten zu können.
Sehr geehrte Frau Moehring,
zunächst bedanke ich mich für Ihre Auseinandersetzung mit meinen Einwänden. Da Sie mich direkt ansprechen, erlaube ich mir auf einige Aspekte zu antworten:
I.
Ad „Autorität“ im Allgemeinen: Sie schreiben, Autorität auf die subjektive Zustimmung des Einzelnen zu reduzieren, bedeute die Verwerfung jeglicher gesellschaftlicher Ordnung. Gegenfrage: Woher nehmen staatliche Institutionen ihre Autorität? Auf Gott kann sich ein säkularer Staat nicht berufen. Und dennoch funktioniert der Staat, weil sich eine ausreichende Zahl von Bürgerinnen und Bürgern auf Grundprinzipien verständigt hat. Siehe dazu: John Rawls, Political Liberalism (1993). Ordnung funktioniert eben auch auf Basis von Verständigung und Vereinbarung.
II.
Ad „Autorität Christi“: Sie schreiben, Christus habe mit selbstverständlicher Autorität gesprochen. Ich denke, hier müssen wir ein anderes Wort verwenden: Christus sprach mit Souveränität. Gott (und damit Christus) ist der absolute Souverän. Das äußert sich auch darin, was es bedeutet, wenn er „spricht“. Denken Sie an die Genesis (1,3): „Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.“ Sprechen und Sein sind hier eins. Und wie haben die Leute auf Jesus reagiert? „Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre; denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten.“ (Mt 7,28f) Die Schriftgelehrten sind die Autoritäten in den Augen ihrer Mitmenschen, Gott (Christus) aber ist mehr, er ist Souverän.
III.
Ad „Apostolische Sukzession“: Wenn Sie sich den Artikel „Successio apostolica“ im Lexikon für Theologie und Kirche (3. Auflage) ansehen, werden Sie merken, dass damit viel mehr und teilweise auch anderes gemeint ist als „die Nachfolge der Bischöfe in ununterbrochener Generationenfolge zu den ersten Aposteln“: Ursprünglich geht es um die kontinuierliche Weitergabe des Christuszeugnisses. Der formale Aspekt der ununterbrochenen Reihenfolge wird erst schlagend, als im Mittelalter Bischöfe hervorkommen, die aus machtpolitischen Gründen ihr Amt erhalten, ohne eine entsprechende theologische Bildung oder Rückbindung im Glauben zu haben. Tatsächlich ist die Sukzession nicht nur untrennbar mit der Tradition, sondern auch mit der Communio der Kirche verbunden. Denn wie wollen wir in den Fällen verfahren, in denen Bischöfe vom Glauben abgewichen sind und/oder die Gemeinschaft der Kirche verlassen haben? Allein am formalen Aspekt kann es also nicht liegen. Dazu ist zu sagen, dass Tradition kein stabiles, sondern ein sich entwickelndes Element ist. Genau das unterscheidet sie ja von der blanken Historie, die abgeschlossen in der Vergangenheit liegt.
IV.
Ad „Ergänzung von Mann und Frau“: Hier gilt es zu unterscheiden: Für die Zeugung ist beim Menschen etwas Weibliches und etwas Männliches notwendig (im Tierreich finden wir mitunter die Ausnahme der Parthenogenese, der eingeschlechtlichen Fortpflanzung). Es gibt also in diesem einen umschriebenen Bereich Aufgaben, die einerseits nur ein Mann, andererseits nur eine Frau vollbringen kann. Aber: Was bringt uns dazu, diese Unterscheidung außerhalb dieses faktischen Bereiches fortzusetzen, also in Bereiche, wo sie keine Bedeutung hat? Ist die Tatsache, dass Christus ein Mann war, heilnotwendig oder eine sekundäre Angelegenheit? Durch Christus wurde Gott Mensch. Das ist entscheidend. Wenn es um die Repräsentanz Christi geht, muss das ein Mensch sein. Die Aussage, dass das ein Mann sein muss, überspannt durch Metaphern das, was offenbart wurde.
V.
Ad „Kinder“: Auch der Ausdruck „Kinder Gottes“ ist ein Bild, erweitert um „(Mit)-Erben“ (Röm 8,17). Das Bild umschreibt das Verhältnis Gott zu Mensch und umgekehrt. Ein anderes Beispiel: Beachten Sie , was Paulus (1 Kor 13,11f) schreibt: „Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.“ Hier wird die Metaphorik direkt angesprochen.
Der einzige, auf den der Begriff „Kind Gottes“, näher hin „Sohn Gottes“, tatsächlich zutrifft, ist Christus. Die Bezeichnung „Kinder Gottes“ für Menschen, steht – ähnlich wie „Volk Gottes“ – auf einer anderen, indirekten Ebene. Benedikt XVI. hat im ersten Band seiner Jesus-Bücher (S. 174f) auf die Besonderheit hingewiesen, dass wir nur in Gemeinschaft mit Christus „Kinder Gottes“ sind. Zudem heißt es da auf Seite 174, das „Bild vom Vater“ im Vaterunser sei geeignet, „die Andersheit von Schöpfer und Geschöpf, die Souveränität seines Schöpfungsaktes auszudrücken“. Und auf Seite 172f schreibt Benedikt XVI.: „Es wird sichtbar, dass ‚Kindsein‘ [im Gegenüber zu Gott, Anm.] nicht Abhängigkeit, sondern jenes Stehen in der Beziehung der Liebe ist, das die menschliche Existenz trägt, ihr Sinn und Größe gibt.“
Da es sich aber um Bilder handelt, können wir unser Verhalten nur dann danach richten, wenn dies vernünftiger Weise auch im eigentlichen Verhältnis (also dem, das die Metapher beschreiben soll) geboten ist. Ich zitiere die Enzyklika „Fides et ratio“: „Denn die Kirche hält zutiefst an ihrer Überzeugung fest, daß sich Glaube und Vernunft ‚wechselseitig Hilfe leisten können‘, indem sie füreinander eine Funktion sowohl kritisch-reinigender Prüfung als auch im Sinne eines Ansporns ausüben, auf dem Weg der Suche und Vertiefung voranzuschreiten.“
Die kirchliche Lehre entbindet meines Erachtens den erwachsenen, von Gott frei gewollten Menschen nicht davon, sich selbst entscheiden zu müssen. Dazu sind aber Prüfung und Hinterfragen notwendig. „Prüft alles und behaltet das Gute!“ (1 Thess 5,21)
VI.
Ad „Verzicht auf die eigene Familie“: Das ist interessant, wenn Sie die rein menschliche Vorschrift des Zölibats in die selbe Liga wie die Frage des Frauenpriestertums stellen. Denn vom Zölibat kann dispensiert werden und es wird auch dispensiert, auch Bischof Voderholzer hat einen verheirateten Familienvater zur Priesterweihe zugelassen: siehe: https://www.katholisch.de/artikel/40230-wie-dieser-priester-beruf-und-familienleben-unter-einen-hut-bekommt.
Der Zölibat gehört nicht wesentlich zum Priestertum, man könnte höchstens sagen, dass er ihm angemessen ist, wie das das II. Vatikanum getan hat. Deshalb ist der Zölibat auch kein Argument gegen das Frauenpriestertum. Und wenn sie von einem „spirituellen Vater“ sprechen, dann kann ich nur sagen: Manche Menschen wollen wohl lieber eine spirituelle Mutter – warum sollte es das nicht geben?
VII.
Ad „Heimat“: Sie schreiben, die Kirche müsse Heimat und Halt für alle Generationen bleiben. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber die Kirche entzieht sich gerade jenen Menschen, welche die Mehrheit meiner Generation in Mitteleuropa bilden, indem sie überkommene Dinge, die den Glauben im Kern nicht tangieren, aufrecht erhält. Die Argumente gegen das Frauenpriestertum sind schwach und sie werden auch durch ständige Wiederholung nicht besser.
Schluss:
Liebe Frau Moehring, Sie werden mir in vielem nicht zustimmen. Das macht aus meiner Sicht nichts: Ich achte Ihre Meinung, auch wenn ich mich ihr nicht anschließen kann. Und ich erhoffe nichts weiter, als meine Meinung in der Kirche sagen zu dürfen, ohne dass man an meinem Glauben zweifelt. Mich hält die Kirche in ihrer Weite sicher aus.
Mit besten Grüßen,
Heinz Niederleitner.
Lieber Bischof Oster,
liebe Frau Moehring,
lieber Herr Niederleitner,
in allen Äußerungen sehe ich viele kluge Gedanken – ein seltener Glücksfall, dass in einem so flüchtigen Medium wie dem Internet noch so tiefgreifende philosophische und theologische Gedanken möglich sind!
Eine kurze Anmerkung möchte ich nur zur Auffassung von Herrn Niederleitner, dass Autorität immer von der Zustimmung der Mitmenschen abhänge, machen.
In den Evangelien finden sich eine ganze Reihe von Passagen, in denen Jesus die Zustimmung seiner Mitmenschen entzogen wurde: bei seinem Auftreten in Nazareth, bei Diskussionen mit Schriftgelehrten und Pharisäern, vor Pilatus und den Hohenpriestern, und vom Volk in Jerusalem, das lieber den Aufrührer Barrabas freilassen wollte als Jesus.
Hatte Jesus in diesen Momenten keine Autorität? Oder bestand seine Autorität nicht gerade darin, dass er dem Willen Gottes folgte statt zu sagen, was die Mehrheit von ihm hören wollte?
Ich bin mir bewusst, dass es nicht einfach ist, in diesem Geist heutige Herausforderungen zu bewältigen; aber mir scheint, dass politische Kriterien wie Zustimmungsfähigkeit und politische Verfahrensweisen nicht im Mittelpunkt stehen sollten. Im Gegenteil würden sie zu einer Selbstsäkularisierung der Kirche und zur Entfernung von Jesus führen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen Mut, uns zu Jesus zu bekennen.
St. Baus
Sehr geehrter Herr Baus,
wenn ich meine Unterscheidung zwischen Autorität und Souveränität durchziehe, dann verliert Christus nie seine Souveränität – und nur darauf kommt es bei Gott an. In seiner Menschwerdung hat sich Gott gewollt angreifbar gemacht – bis zum Letzten, bis zum Tod am Kreuz. Was ist das anderes als die äußerste Form von Autoritätsverlust unter Menschen, wenn alles genommen wird – auch das Leben? In seiner Souveränität hat Gott dann zum Guten gehandelt. Deshalb nochmal: Menschen mögen mit Autorität agieren, Gott hat Souveränität.
Heinz Niederleitner.
Lieber Bischof Oster,
ich verstehe Ihr Kernargument: Ihrer Auffassung zufolge hat Papst Johannes Paul II eine unfehlbare Lehrentscheidung gegen das Frauenpriestertum getroffen. Deshalb sei dies nun endgültig so „zu glauben und zu halten“. Und an dieser Entscheidung sei aus Ihrer Sicht „nichts mehr zu ändern“.
Aus meiner Sicht verlassen Sie an dieser Stelle die Mehrheit der Synodalen und der Gesellschaft. Der Grund ist recht einfach: Während die Mehrheit der Synodalen im Bemühen der Wahrheitsfindung Argumente für oder wider das Frauenpriestertum austauschen und wägen, entziehen Sie sich diesem Prozess und sagen: „Die Sache wurde bereits entschieden.“ M.a.W.: Roma locuta, causa finita.
Es würde mich sehr interessieren, weshalb Sie sich mit einer historisch getroffenen Entscheidung begnügen. Ich würde so gerne wissen, was Sie veranlasst, darüber hinwegzugehen, dass Entscheidungen historisch und damit kontingent sind. Ich würde so gerne wissen, wie Sie es vor sich und Gott rechtfertigen, theologisch noch so gute Arguemente, wie Sie selbst eingestehen, einfach links liegen zu lassen, nur weil ein Papst in der Geschichte der Kirche, eine abweichende Entscheidung gefällt hat. Warum binden Sie sich lieber an eine Entscheidung der Vergangenheit, als den besten verfügbaren Argumenten zu folgen? Warum ignorieren Sie unter Rekurs auf ein Autoritätsargument, das bekanntermaßen zu den schlechtesten Argumenten überhaupt zählt, die vielen guten Argumente?
Die Geschichte hat doch zuhauf gezeigt, welch fatale Folgen die Haltung zeitigen kann, sich an Entscheidungen der Obrigkeit zu halten, ohne diese zu hinterfragen. Was gibt Ihnen die Sicherheit, dass ausgerechnet diese Entscheidung der Vergangenheit, gegen die so viele ausgezeichnete theologische Argumente sprechen, gleichwohl die von Gott gewollte ist? Woher nehmen Sie diese Gewissheit?
Obwohl es sogar – wie Sie zugeben – laut theologischer „Fachleute“ umstritten ist, dass die Entscheidung von Johannes Paul II unfehlbar war, und obwohl Sie sogar der Auffassung sind, dass mit der Autorität eines neuen Konzils die Entscheidung geändert werden könnte, warum treten Sie dennoch unaufhörlich das „causa finita“ breit und ruhen sich darauf aus?
Ich würde das so gern verstehen. Und ich wünschte so sehr, Sie könnten mir dies erläutern.
Mit freundlichen Grüßen
CT
Sehr geehrter Herr Tuillon,
haben Sie herzlichen Dank für Ihren Kommentar, dessen Fragen und Pointe ich allerdings nicht recht verstehe. Denn gerade das ist doch meine Voraussetzung: Ja, ich glaube, es handelt sich um eine unfehlbare Lehrentscheidung, zu der Johannes Paul II. als Papst das Recht hatte – und er hat es ausdrücklich auch als unfehlbare Erklärung bestätigt.
Was dann Argumente und Erläuterungen dazu angeht: Das versuche ich auf der Basis meiner theologischen und philosophischen Begründungen die nächsten knapp 1,5 Stunden. Mag ja sein, dass Ihnen das nicht genügt. Aus meiner Sicht ist es intellektuell und spirituell plausibel – und daher halte ich es für wahr. Die anderen guten theologischen Argumente lass ich nicht einfach links liegen, sondern halte meine für plausibler und überzeugender. Und Wahrheit ist selbstverständlich keine Frage von Mehrheit.
Herzlicher Gruß
SO
Lieber Bischof Oster,
vielen Dank für Ihre Antwort. Ich werde noch einmal anders versuchen, meine Pointe zu verstehen zu geben:
Was ich verstehe: Sie halten die Entscheidung des Papstes für unfehlbar. Und sie ist es in Ihren Augen, weil er sie als unfehlbar erklärt hat. Das ist ein Argument der Form: „Die Proposition p hat die Eigenschaft a, weil Person P das gesagt hat.“ Dies ist ein extrem unplausibles, schlechtes Autoritätsargument.
Ob p die Eigenschaft a besitzt, muss erwiesen werden. Die Tatsache, dass P die Frage beantwortet hat, gibt auf diese Frage keine Antwort. Auch der Hinweis, dass P p die Eigenschaft zugeschrieben hat, gibt auf diese Frage keine Antwort.
Konkret: Der Umstand, dass Papst Johannes Paul II die Frage nach der Frauenordination entschieden hat, erweist seine Entscheidung nicht als richtig oder falsch. Und der Umstand, dass er sie als unfehlbar erklärt hat, tut dies genauso wenig. Richtigkeit, Wahrheit etc. wird ja nicht per Deklaration erzeugt.
Fragen wie: Ist das Verbot der Frauenordination richtig? Wird sie den Frauen gerecht? Ist sie in Gottes Sinne? u.v.m. wird durch den Hinweis, dass sie in der Vergangenheit schon einmal entschieden wurden, nicht beantwortet. Ich kann nicht sehen, dass Sie sich diesen Fragen wirklich stellen, geschweige denn, dass Sie sie beantworten.
Wenn es sein kann, dass eine getroffene Entscheidung – jedenfalls in der heutigen Zeit – eine falsche, ungerechte, göttliche Berufungen verhindernde Entscheidung ist, dann muss man diese Möglichkeit würdigen. Wenn wir keine Gewissheit in der Frage haben (können), dass Gott keine Frauen zum Priesteramt beruft, müssen wir doch wenigstens die Möglichkeit anerkennen. Dann aber scheint es mir unmöglich, sie unter Verweis darauf, dass ein Papst die Frage aber schon anders entschieden hat, beiseite zu wischen.
Die Richtigkeit von Entscheidungen zu klären, ist etwas ganz anderes als die Frage zu klären, ob sie schon einmal gefällt wurden. Ersteres stellt die Geltungsfrage, zweiteres eine Frage an einen Protokollführer. Mir scheint, Sie beantworten die Geltungsfrage dadurch, dass Sie unter Rekurs auf die „Beschlusssammlung“ antworten: „Eine Entscheidung wurde bereits gefällt, die Sache ist erledigt.“ (M.a.W.: Roma locuta, causa finita.) Aber das ist schlicht ein Kategorienfehler.
Verstehen Sie nun etwas besser, was ich meine?
In Ihren sich anschließenden in der Tat sehr ausführlichen religiösen Betrachtungen konnte ich leider kein Argument entdecken, das zur Konsequenz hätte, dass es keine Frauenordination geben kann oder darf. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich eines übersehen habe, und weisen Sie mich gerne auf ein solches hin.
Mit freundlichen Grüßen
CT
An das Redaktionsteam: Von den Kommentaren (8) werden nur manche (4) im öffentlichen Bereich angezeigt. Ist das ein technischer Fehler oder beabsichtigt?
Sehr geehrter Herr Bischof Oster,
In Ihren Darlegungen zitieren Sie den Epheserbrief unvollständig. Sie lassen die Aufforderung an die Frauen weg, sich ihren Männern unterzuordnen und zitieren nur die Mahnung an die Männer, ihre Frauen zu lieben. Im heutigen katholischen Verständnis der christlichen Ehe ist eine einseitige Unterordnung der Frauen ja auch nicht geboten. Vielmehr gilt für Mann und Frau gleichermaßen, was in Eph 5,21 als Einleitung über diesem Abschnitt steht: „Einer ordne sich dem andern unter in der gemeinsamen Furcht Christi!“. In der Liturgie der Trauung geben sich beide Ehegatten deshalb auch ein gleichlautendes Versprechen. Ich gehe davon aus, dass Sie dem zustimmen und deshalb das Zitat gekürzt haben.
Mit dieser Verkürzung wird jedoch die Problematik des verwendeten Bildes ausgeblendet:
Anders als in einer heutigen Ehe kann das Verhältnis zwischen Christus und der Kirche kann nicht gleichberechtigt gedacht werden. Er ist der Herr, der sie erworben hat, dem sie gehört und dem sie zum Gehorsam verpflichtet ist. Das biblische Bild von Bräutigam und Braut für Christus und Kirche ist ganz patriarchalen Verhältnissen verhaftet. Es ist daher heute nicht mehr ohne Relativierung verständlich. Unmittelbare Schlüsse vom Bild auf heutige Praxis können nicht ohne weiteres gezogen werden.
Wenn wir die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Ehe heute bejahen, folgt daraus: Sowohl Mann als auch Frau sollen die Partnerin / den Partner lieben, wie Christus die Kirche liebt und zugleich sich ihr/ihm unterordnen, wie sich die Kirche Christus unterordnet. Sowohl Mann als auch Frau nehmen in der Ehe sowohl die Rolle Christi als auch die der Kirche ein.
Wenn solch partnerschaftliches Miteinander in der Ehe entgegen der patriarchalen Tradition dem Willen Gottes entspricht, warum sollte dann nicht auch ein gleichberechtigtes Miteinander der Geschlechter in kirchlichen Ämtern trotz der patriarchalen Tradition Gottes Willen entsprechen?
In der Tradition der Kirche wurde die Frau über Jahrhunderte als minderwertiger und unvollkommener Mensch angesehen. Zugleich wurde ihre aktive Rolle in der Weitergabe des Lebens verkannt. Unter dieser Voraussetzung wurde ihr die notwendige natürliche Ähnlichkeit mit Christus abgesprochen, die für die Priesterweihe Voraussetzung ist.
Ohne diese falschen Voraussetzungen gilt auch das vermeintliche Argument der Unähnlichkeit nicht mehr, vielmehr gilt nicht mehr männlich und weiblich: In der Taufe sind alle – Männer wie Frauen – eine neue Schöpfung geworden und haben Christus als Gewand angezogen. Das heißt sie sind ihm so ähnlich, dass sie beauftragt werden können, sakramental in seiner Person handeln können.
Dass dies möglich ist, zeigt auch die Gültigkeit der Taufe durch Frauen, die im Notfall geboten ist. Wie bei der Eucharistie ist der eigentliche Taufspender Christus als Haupt der Kirche. In seiner Person handeln auch Frauen, die gültig taufen.
Mit freundlichem Gruß
Christoph Uttenreuther
Sehr geehrter Herr Pfarrer Uttenreuther,
haben Sie herzlichen Dank für Ihre Überlegungen, die ich nachvollziehen kann, die aber meinen Ansatz aus meiner Sicht nicht wirklich berühren.
Wie Sie aus diesem und anderen Beiträgen zum Synodalen Weg vielleicht ersehen können, ist mein Ausgangspunkt eine Art „Ontologie personaler Liebe“. Diese Liebe, die ursprünglich in Gott ist und die Gott selbst ist, ist der Grund, warum es überhaupt etwas gibt und warum es uns gibt. Ihr zu glauben und zu vertrauen, sie zu empfangen, zu beantworten und zu verschenken – und so zu lernen ein absichtslos liebender Mensch zu werden, ist der Sinn unseres Lebens.
Und wenn Gott den Menschen männlich und weiblich erschafft – als sein Ebenbild, dann schafft er ihn ursprünglich in „heiler Welt“, d.h. in einer Welt, in der Macht und Begehren in ihren negativen Konnotationen noch keinen Raum haben. Sie folgen erst „nach“ jener Entfremdung, die die Schrift als „Sündenfall“ erzählt. Erst jetzt also gibt es so etwas wie „patriarchale Strukturen“ im Verhältnis zwischen Mann und Frau, gibt es Beherrschung und Begierde (vgl. Gen 3,16). Der Mensch ist jetzt desintegriert.
Nach meiner Überzeugung kommt Christus in diese Welt, um die „heilen Verhältnisse“ des Ursprungs wieder herzustellen, den Menschen aus der Desintegration wieder in die tiefere Integration zu führen. D.h. darin spielen dann auch „patriarchale Bilder“ und Denkmodelle wenn überhaupt nur eine nachgeordnete Rolle. Christus kommt durch das Ja einer Frau (die nur nebenbei bemerkt das heilste Geschöpf war, das je über diese Welt gelaufen ist) als Mann in diese Welt – in unfassbarer Erniedrigung, die zugleich dem Geschöpf Erhöhung verheißt. Das heißt: Die Vollmacht, die er ausübt, ist schöpferische Macht der Liebe, die sich verschenkt, die sich erniedrigt und „ausleert“ (exinanitio). Das Ja der Frau ist schöpferische Antwort der geschaffenen Liebe auf die ungeschaffene Liebe. Letztere hebt durch ihre Erniedrigung das Geschöpf in die Sphäre göttlicher Liebe. Es ist unglaublich, aber wahr: das heile Geschöpf (Maria) kann dasselbe tun, was der Vater tut: Den Sohn der Welt geben!
Und dieses Handeln der erlösenden göttlichen Liebe drückt sich eben in dem Zueinander von Mann und Frau und analog im Zueinander von Christus und Kirche aus. Dass wir das inmitten gebrochener Strukturen erleben und denken müssen, ist offensichtlich. Der Mensch, auch die Menschen der Kirche, sind nicht einfach heil – und daher kreisen wir auch um Machtfragen: Wer darf was wie machen und wo Macht ausüben? Und wer unterdrückt wen, weil er etwas nicht kann oder darf?
Meines Erachtens liegen die entscheidenden Fragen aber tiefer, eben jenseits von Machtfragen – und hineingestellt in eine heile Ursprünglichkeit. Dass Machtfragen hineinspielen, ist – wie gesagt – nur zu verständlich. Und je weniger heil wir alle sind – umso mehr werden sie hineinspielen. Es ist analog zum Beispiel zum priesterlichen Amt: Ereignet sich sakramental etwa Wandlung oder Lossprechung auch dann, wenn der Priester ein Verbrecher ist? Die Kirche hat immer gesagt: Ja, natürlich. Nicht, weil der Priester so eine großartige Gestalt wäre, sondern weil Gott die Kirche so verrückt liebt, dass er ihr objektiv „verlässliche Gnadengaben“ schenkt – trotz der Verfehlungen der Vermittlungsgestalten. Dass wir Priester das einmal vor unserem Herrn verantworten müssen, wie wir Ihn repräsentiert haben, keine Frage. Aber für das Volk Gottes ist Beichte Beichte und Eucharistie Eucharistie, unabhängig von der moralischen Integrität (und damit z.B. auch unabhängig von schlechter Machtausübung) ihrer Spender.
Analog sehe ich es mit der Ehe: Die Verbindung von Mann und Frau ist in der Tiefe gehalten vom Herrn – gewissermaßen zurückgenommen in den Ursprung heiler Welt. Diese ist da – auch wenn sie in der Gebrochenheit der Eheleute oft nicht sichtbar wird und von unguten Macht- und Begierdeverhältnissen und dem Streit darum mit durchdrungen oder überlagert wird. Analog im Verhältnis Christus-Kirche: Das heile Verhältnis ist da, auch wenn die Amtsträger und die Gläubigen als gebrochene Menschen um Machtverhältnisse streiten. Letztlich gehört dieser Streit um „Macht“ in diese Ursprungsfrage aber nicht mit hinein, sondern gerade eher hinaus. Freilich räume ich sofort ein, dass sich das Problem verschärft durch das Handeln von (uns) Priestern, die im Gang der Geschichte Frauen immer wieder und bis heute als Menschen zweiter Klasse behandelt haben. Das ist Sünde mitten in in einer Struktur, die dem Heil dienen soll.
Aber letztlich geht es nach dem, was ich oben sagte, um die Frage: Hat Gott das heile Zueinander von Mann und Frau auch als Abbild des heilen Zueinanders von Christus und Kirche gewollt und gewählt. Ich glaube ja. Ich glaube, es ist kein biologischer Zufall, dass Christus ein Mann ist und von sich sagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Dass er also zu Gott auch Vater sagt, während er ein leibliche Mutter hat, die zugleich die Gestalt der (mütterlichen!) Kirche ist, die Gestalt der Braut – die den Gottessohn in die Welt bringt. Wenn das also kein Zufall ist (was ich glaube), dann ist das Zueinander von Mann und Frau im „Hochzeitsmahl des Lammes“, im „neuen und endgültigen (Hochzeits-)Bund“ nicht beliebig austauschbar. Diese Welt, vor allem der Mensch in seiner Leiblichkeit hat Bedeutung. Christus hat Fleisch angenommen, als Mann aus einer Frau – und darin eben dieses Fleisch von Mann und Frau erneuert, geheilt und geheiligt – und dem Leib von Mann und Frau letztlich sogar unendliche Bedeutung gegeben, aber eben nicht einfach beide Bedeutungsdimensionen austauschbar egalisiert. Wenn also die Frage gestellt wird, ob eine Frau in dieser Feier (Eucharistie als Hochzeit) Christus repräsentieren kann, könnte man in Analogie, etwas zugespitzt und mit Augenzwinkern dennoch mit einer ähnlichen Ernsthaftigkeit die Frage stellen, ob z.B. in einer Ehe ein Mann die Kinder austragen und zur Welt bringen dürfte – oder ob er (von Gott? von der Frau?) biologisch nicht doch gravierend benachteiligt wäre, weil er dieses Erlebnis nicht haben darf. Womöglich missgönnt die Frau dem Mann diese Erfahrung? Sie sehen: Fragen nach Macht und Machtvorenthaltung, nach Gunst und Missgunst verstellen womöglich den Blick auf einen heileren Ursprung, aus dem m.E. aber die Antworten auf diese Fragen liegen und kommen müssten.
(Und hier nur als Nebenbemerkung: Womöglich ist die Debatte um die „Vielfalt der Geschlechter“, die auch in unserer Kirche inzwischen geführt wird, untergründig auch von solchen Fragen mit motiviert)
Ob Ihnen all das weiterhilft, vermag ich nicht zu beurteilen.
Wichtig war mir nur zu sagen, dass trotz des verheerenden Gesamtzustands unserer Kirche in Deutschland, dieser nicht zuerst durch Macht- und Strukturdebatten verbessert werden kann, sondern durch eine Hinwendung, also eigentlich durch Bekehrung zum Vertrauen in den heilen Ursprung aus Gottes Liebe. Ein Leben aus solcher Hinwendung – das haben große Glaubensgestalten in unserer Geschichte immer wieder gezeigt – verändert dann übrigens von innen nach außen auch die Strukturen.
Ihnen beste Segenswünsche für die Fastenzeit
SO
Sehr geehrter Herr Bischof Oster,
In Ihrer Antwort führen Sie nochmals aus, was Sie in ihrem Vortrag bereits darlegen. Ein Eingehen auf meine Argumente erkenne ich nicht. Trotzdem vielen Dank für Ihre Mühe. Vielleicht ergibt sich ja am Rande des Synodalen Wegs einmal die Gelegenheit zum Gespräch.
Auch Ihnen eine gesegnete Fastenzeit
Mit freundlichem Gruß
Christoph Uttenreuther