Glauben wir noch, was wir glauben? Ein kritischer Blick von Bischof Stefan Oster auf das Papier „Geschaffen, erlöst und geliebt. Sichtbarkeit und Anerkennung der Vielfalt sexueller Identitäten in der Schule“ der Schulkommission der Deutschen Bischofskonferenz.
In den vergangenen Wochen sind zahlreiche Rückfragen und Stellungnahmen zum jüngst veröffentlichten Papier der Schulkommission der Deutschen Bischofskonferenz eingegangen. Das Dokument mit dem Titel „Geschaffen, erlöst und geliebt. Sichtbarkeit und Anerkennung der Vielfalt sexueller Identitäten in der Schule“, erschienen am 1. Oktober 2025, hat zudem eine breite innerkirchliche und öffentliche Diskussion ausgelöst. Angesichts dieser Debatte nimmt Bischof Stefan Oster zu dem Papier Stellung und bietet eine kritische Analyse der zentralen Aussagen und theologischen Implikationen:
Glauben wir noch, was wir glauben?
Ein kritischer Blick auf das Papier „Geschaffen, erlöst, geliebt“, das die Schulkommission der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht hat. Es geht dabei, so der Untertitel, um „Sichtbarkeit und Anerkennung der Vielfalt sexueller Identitäten in der Schule“ – erschienen am 1. Oktober 2025.[1]
Über Realpräsenz
Zu Beginn des Synodalen Weges war ich eingeladen, im Frankfurter Dom ein Statement über meinen Glauben und meine Erwartungen an den Synodalen Weg abzugeben. Ich habe dabei erklärt, dass ich das, was wir theologisch „Realpräsenz“ nennen, für das alles entscheidende Thema in unserer Kirche halte. Wir verbinden mit diesem Wort insbesondere den Glauben an die echte, konkrete Gegenwart Jesu Christi in Leib und Seele, Gottheit und Menschheit in der Eucharistie. In der Eucharistie geschieht wahrhaftig Wandlung – und sie geschieht, damit wir als Gläubige uns wandeln und mit uns die Welt. In der Eucharistie werden wir Leib Christi, wir werden mit Paulus gesprochen „Tempel des Hl. Geistes“ (1 Kor 3,17), wir werden „neue Schöpfung“ (Gal 6,15), „Kinder Gottes … mitten in einer verdorbenen und verwirrten Generation“ (Phil 2,15). Jesus spricht im Johannesevangelium, dass es um eine Neugeburt (vgl. Joh 3,3) geht – als Voraussetzung dafür, das Reich Gottes schauen zu können. In moderner Terminologie gesprochen, können wir also davon sprechen, dass die christliche Grunderfahrung in eine neue Identität führt. Der Mensch, der in Christus ist, erkennt sich selbst, erkennt die anderen Menschen und erkennt Gott als Vater in neuer, tieferer, ungeahnter Weise. Er findet in ein anderes Selbstverhältnis, weil er nun mit und durch Jesus mit dem Vater versöhnt ist und sich als Familienmitglied, als Kind Gottes erfahren darf. Paulus mahnt also: „Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ (Eph 4,24)
Neue Schöpfung
Das Neue Testament, wie auch die große christliche Tradition, sprechen immer schon davon, dass diese „Neugeburt“ aus Christus, der unsere Taufe sakramental zugrunde liegt, einen gläubigen Wachstumsprozess einleiten kann. Dieser führt zu einer je tieferen Integration des ganzen Menschen, zur größeren Freiheit, zur tieferen Eingründung in Christus/im Vater, zur beginnenden Heilserfahrung schon jetzt, zur größeren Liebesfähigkeit und anderem mehr. „Heil“ ist das Wort, das das Neue Testament neben anderen dafür bereithält und das in dieser Welt schon befähigt, nicht mehr „Sklave“ von triebhaften Antrieben oder äußeren Motivationen wie der Sucht nach Anerkennung, Macht oder Reichtum zu sein. Heil und Heiligung sind daher auch vom Begriff her nicht weit auseinander. Das II. Vatikanische Konzil spricht daher von der Berufung zur Heiligkeit aller Menschen[2] – durch Christus, durch seine reale Gegenwart, besonders in der Eucharistie. Und davon abgeleitet immer mehr erfahrbar und erkennbar auch in den übrigen Sakramenten, in Gottes Wort, in den anderen Menschen, in der Schöpfung insgesamt. „In allen Dingen“ will Ignatius von Loyola Gott suchen – aber das Herz, das Ihn schauen kann, setzt die eigene Reinigung, die „via purgativa“ voraus (vgl. Mt 5,8).
Tiefere Integration bedeutet also zugleich: mehr Ganzheit. Bei Thomas von Aquin lernen wir, dass die Liebe, die von Gott ins menschliche Leben einwirken darf, eine „vis unitiva et concretiva“ ist, eine Kraft also, die konkret macht, die zusammenwachsen lässt und eint (= con-crescere).[3] Und wenn das tatsächlich ein fundamentum in re hat, ließe sich ein solches Phänomen auch mit den moderneren Begriffen benennen wie „größere Authentizität“, aber eben auch „Identität“ als tragende, die Person neu konstituierendes oder auch stabilisierendes Phänomen, das tiefer in seinem Sein liegt als nur in seinen Eigenschaften. „Werde, wer du bist“ – haben die antiken Philosophen den Menschen deshalb aufgefordert und die Christen haben diesen Imperativ gerne aufgegriffen, aber ihm im Blick auf das Erlösungsgeschehen in Christus eine neue Deutung gegeben. Denn dem heidnischen, antiken Menschen war weit weniger bewusst als den Christen, dass es im Menschen eine Macht gibt, die ihn fortwährend nicht in die größere Integration, sondern in die tiefere Desintegration treibt, nämlich die Sünde. Paulus beschreibt dieses Phänomen in einem abgründigen Abschnitt des Römerbriefs als eine Macht, die in ihm bewirkt, dass er das tut, was er nicht will (vgl. Röm 7,14 ff) – obwohl er es in seiner Vernunft anders einsieht. Der nur „natürliche“ Mensch ist nach Paulus „Fleisch“ bzw. „vom Fleisch bestimmt“, was im Wesentlichen bedeutet, dass er in den eigenen egozentrischen Bedürfnissen und Antrieben lebt, als ob es Gott nicht gäbe.
Die Sünde desintegriert den Menschen, treibt ihn innerlich auseinander. Christus integriert in neuer Identität. Und weil Christus ganz Mensch geworden ist, Geist in Leib geworden ist, vermag auch der von ihm erlöste Mensch auch in ein erneuertes Selbstverhältnis zu finden, das das Verhältnis zum eigenen Leib, zum eigenen Fühlen, zum eigenen Wollen und Denken neu macht, neu zueinander integriert, also mehr ganz, mehr zu dem, was ein Mensch vor Gott ist und sein kann, nämlich heiler und heiliger. Ich will damit sagen, dass uns das biblisch-christliche Menschenbild zugleich ein spezifisch christliches Verständnis von „Identität“ gibt, von neuem Menschsein, vom erlösten Menschsein, vom Kind-Gottes-Sein. Der gläubige Weg des Christen ist identisch mit dem Drama der Selbstwerdung in Gott, der gerade nicht von Anfang an schon gelungen ist, sondern vielmehr mit Hilfe der Gnade Gottes errungen werden will.
„Identität“ – was ist gemeint?
Der Begriff „Identität“ wird nun in dem oben genannten Text der Schulkommission beinahe inflationär verwendet – zumeist in den Zusammensetzungen „geschlechtliche Identität“ und „sexuelle Identität“. Dabei macht der Text schon in der Einleitung klar, dass „sexuelle Identität“ der Oberbegriff ist, der inhaltlich die beiden anderen Begriffspaare umfasst, nämlich „geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung“. Gleich zu Beginn legt der Text auch offen, woher er diese Begriffsbestimmungen nimmt, nämlich „analog zum deutschen Rechtssystem (vgl. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) als Sammelbegriff für sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität“[4]. Interessant ist dabei, dass die komplexen Sachverhalte, die mit den genannten Begriffspaaren gemeint sind, an keiner Stelle des Textes ausführlicher diskutiert oder gar problematisiert werden. Sie sind gesetzt und setzen damit ein Menschenbild der Vielfalt voraus, das fortwährend insinuiert, dass in jungen Menschen ihre sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten wie naturhaft zugrunde lägen – und dass es dann auch im Schulkontext vor allem darum gehe, diese zu entdecken und in gelingender Weise zur guten Entfaltung zu bringen. Von dem viel umfassenderen Verständnis von Identität aus christlicher Sicht: kein Wort. Auch in dem kurzen Abschnitt, in dem es ausdrücklich um den Religionslehrkräfte und ihren Unterricht geht, kein Wort dazu. Aber es wird umgekehrt im Geleitwort ausdrücklich Bezug auf den Synodalen Weg in Deutschland (S. 5), der sich in zwei Handlungstexten zu Fragen der Vielfalt sexueller Identität geäußert habe. Die Ironie dabei ist, dass das Forum IV des Synodalen Weges zum Thema „Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“, dessen Mitglied ich auch war, als einziges der vier Foren keinen gültigen Grundtext verabschieden konnte. Denn ursprünglich sollten die so genannten Handlungstexte auf den Einsichten eines Grundtextes aufbauen. Ein Grundtextentwurf dazu hatte die Absicht, die Grundlinien einer neuen katholischen Sexualethik aufzuzeigen, aber der Textvorschlag hatte nicht die nötige Mehrheit gefunden und war deshalb gescheitert. Jetzt aber legt man einen schulpädagogischen Text vor, der überaus selbstverständlich unter Bezugnahme auf den Synodalen Weg mit dem Begriff „sexuelle Identität“ hantiert, ohne diesen in irgendeiner Form zu diskutieren, geschweige denn zu problematisieren.
Die Schule als eine Art Geburtshelfer – für welche Geburt?
Demnach soll sich nun eine Schule so aufstellen, dass sie so etwas wie Geburtshelferin der Entdeckungsreise werden kann zu einer – wie es programmatisch heißt – „ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung“ (S.24ff). Das Unverständiche dabei ist, dass wir es immerhin mit einem Papier zu tun haben, das auf dem Titel „Die deutschen Bischöfe“ stehen hat – ohne dass unser christliches Verständnis von „ganzheitlichem“ Personsein und Personwerden in irgendeiner Form zur Sprache käme. Jugendliche sollen nach dem Duktus des Papiers in der Schule sensible Begleitung und positive Bestärkung finden können, in dem, was sie sind und sein wollen: „Eine Schule, die die Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbildung aller Schülerinnen und Schüler fördern will, kann die Situation von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und non-binären Jugendlichen nicht ignorieren. …. Sie muss die Situation und Bedarfe dieser queeren Personen berücksichtigen“, heißt es auf Seite 9. Und auch wenn im Geleitwort zum Text vorher betont wurde, dass man „keine moraltheologische Analyse und Beurteilung der Vielfalt sexueller Identitäten“ leisten wolle, erhebt sich an dieser Stelle nun plötzlich doch eine massiver „moralische(r) Anspruch, der Teil eines umfassenden, vom Glauben inspirierten und darin orientieren (schul-)pädagogischen Ethos ist. Dieses gipfelt – wie das christliche Ethos insgesamt – in der Nächstenliebe als Ausdruck der Liebe Gottes zum Menschen und der Menschen zu Gott (Vgl. 1 Kor 13,13b).“ Zugleich nennt der Text eher beiläufig, dass es vom Lehramt her „erhebliche Vorbehalte“ gebe „in Bezug auf die Lebensführung vieler queerer Menschen“, sagt aber selbstverständlich sofort, dass diese „im Licht humanwissenschaftlicher wie theologisch-anthropologischer Erwägungen angefragt werden“ (S. 10). Deshalb auch habe ein Religionslehrer „die Sexualmoral der Kirche differenziert“ darzustellen und „das Kontroversitätsgebot“ zu befolgen – was bedeutet, dass die Lehre als „umstritten“ gelte und daher auch so dargestellt werden solle, „damit die Schülerinnen und Schüler sich ein eigenes begründetes Urteil bilden können“ (S. 38f.) Die Zielrichtung des Textes scheint mir damit klar vor Augen zu liegen: Insgeheim wird suggeriert, dass das eigentliche Ziel der jugendlichen Identitätsfindung schon in ihnen selbst vorliegt – und die pädagogische Begleitung eine Art sensiblen Geburtshelferdienst leisten soll. Daher werden die sehr wenigen Bemerkungen zur Lehre der Kirche in diesem Feld in einer Weise problematisiert, dass klar ist, dass sie im Grunde nicht für diesen Dienst taugen, sondern den Prozess der Identitätsfindung eher mit dem Verdacht belegen, diesen zu behindern, statt zu befördern.[5] Sie taugen eher dazu, Fremdbestimmung durch veraltete Moral zu fördern, statt Selbstbestimmung durch moderne Pädagogik zu erreichen.
Die Humanwissenschaften und ihre Perspektive
Das Problematische dabei ist, dass das Papier zwar einerseits nicht moraltheologisch argumentieren will (vgl. S. 5, „keine umfassende moraltheologische Analyse“), dann aber doch massiv theologisch daherkommt, und damit in jedem Fall indirekt deutlich macht, dass es lehramtliche Positionen für keineswegs hilfreich hält. Das erste Argument kommt schon mit der Überschrift des gesamten Textes: „Geschaffen, erlöst, geliebt“ heißt das ganze Papier. Nirgendwo wird dabei der Begriff „erlöst“ erläutert, sondern selbstverständlich vorausgesetzt: Im Grunde sind alle Menschen in all ihrer Diversität, so kann man das lesen und so zieht es sich auch durch den Text, je schon erlöst. Dieses Erlöst-sein bezieht sich deutlich auf das So-geschaffen-sein in aller Diversität, zugleich erklärt der Text: „die Vielfalt sexueller Identitäten ist ein Faktum“ (S. 5). Von der Aufgabe menschlicher Selbstwerdung in Christus und durch Christus ist an keiner Stelle die Rede. Dafür werden umso deutlicher humanwissenschaftliche Erkenntnisse betont, ohne zu spezifisch zu sagen, welche das wären. Das Problem dabei ist: Humanwissenschaften nehmen den Menschen in ihrer konkreten Vorfindlichkeit wahr – und haben qua Methode keinen Zugang zum genuin christlichen Menschenbild mit seinen Voraussetzungen von Glaube, Gottesbeziehung, Erlösungsbedürftigkeit, Gnade, Sünde, Heil und der Aufgabe und Einladung, Christus ähnlicher zu werden. Daher wird zwar im Text dennoch der „Primat der Liebe Gottes“ stark betont (S. 11), aber zugleich wird er von dem abgelöst, was als Wahrheit und Lehre über den Menschen tradiert ist. Mit diesem Kniff kann dieser „Primat der Liebe Gottes“ dann unterschiedslos über alles an „Vielfalt“ ausgegossen werden, was sich so zeigt. Gemeint ist selbstverständlich die Vielfalt in der Diversität der sexuellen Identitäten. Diese müssen – eben, weil Gott sie so liebt und mutmaßlich so geschaffen hat (siehe Titel) – eben auch anerkannt werden. Der Mensch in seiner Vorfindlichkeit ist das Maß der Dinge. Die Deutung der Offenbarung hat sich offensichtlich danach zu richten, was sich als angebliches „Faktum“ neu zeigt.
Der Trick mit der Vorverlegung von Gottes Schöpferwillen
Aber dass die geschaffene Welt und in ihr vor allem jeder Mensch keineswegs schon erlöst, sondern als ganzer Mensch dringend erlösungsbedürftig ist – wird mit keinem Wort erwähnt. Denn eine Problematisierung von „Erlösung“ würde ja den Grundansatz: „Ich bin, wie Gott mich schuf“ zunichte machen. Es braucht also in der Begründung die unausgesprochene Zurückverlegung aller queeren und sexuellen Identitäten schon in den Schöpfungswillen Gottes. Eine solche Rückverlegung erreicht damit auch die Eliminierung kritischer Anfragen, die aber tatsächlich aus der Offenbarung kommen. Wenn es die Erlösung durch Christus nicht mehr braucht, weil der Mensch ja schon kraft Schöpfung in jeder Art seines Soseins schon in Ordnung ist, dann hätte es das Drama des Kreuzes auch nicht gebraucht. Und wenn das Drama des Kreuzes so interpretiert wird, dass sich darin schon die Erlösung aller wie in einer Art Automatismus auf jeden Menschen in seinem vielfältigen So-sein erstreckt, dann hätte auch das mit dem Evangelium wenig zu tun. Der Mensch, ausnahmslos jeder Mensch, ist – nicht nur aber auch – ein gebrochenes, desintegriertes Wesen. Jeder Mensch braucht daher die Begegnung mit Christus für sein Heil, für sein Mehr-ganz-werden. Christus ist der Erlöser aller Menschen. Der vorliegende Text der Schulkommission aber scheint davon auszugehen: Jede Diversität im Blick auf sexuelle Orientierung und sexuelle Identität ist schon gottgewollt, weil: „geschaffen, erlöst und geliebt“ (=Gesamtüberschrift). Daher suggeriert er mit nahezu jeder Zeile: „Ja nicht zuviel Sexualmoral, schon gar nicht der Anspruch auf Wahrheit“ – dafür eine Überdosis eines gefühlsbeladenen Superdogmas: „Gott hat alle genau so lieb, wie sie sind“. Deshalb darf auch keiner in seiner Diversität kritisch angefragt werden, das wäre ja schon Diskriminierung. Tatsächlich aber gilt auch hier wieder christlich für ausnahmslos jeden Menschen: „Ja, Gott liebt Dich wie Du bist – aber er will nicht, dass Du bleibst, wie Du bist. Er will, dass Du durch Seine Gnade Christus ähnlicher wirst.“ Auf die Idee freilich, dass die Botschaft des Glaubens in ihrer existenziellen Tiefe wirklich ein lebensveränderndes Heilsangebot sein kann, kommt in diesem Text niemand mehr. Glauben wir also noch, was wir glauben?
Paradoxerweise soll das „Genau so von Gott gewollt und geliebt“ auch für transidente Menschen gelten, die sich Angleichung ihrer leiblichen Geschlechtsmerkmale an das neue Geschlecht wünschen. Aber wenn Gott den Menschen so gewollt hätte, wie er sich fühlt – nämlich im falschen Körper – bezieht sich dann das Wollen Gottes nur auf die innere Selbstidentifikation, im verkehrten Körper zu sein? Ist also auch der hier hochproblematische Begriff von „Identität“ in allererster Linie identisch mit dem, wozu ich mich selbst bestimme – und bestimmen kann? Würde dann der göttliche Schöpfungswille nur diese innere Selbstwahrnehmung meinen, aber nicht den Leib, den er zwar auch geschaffen hat, aber womöglich nur zufällig oder gar fehlerhaft wie verfügbares Leibmaterial hinzugefügt hat, weil er nicht ganz so wichtig ist? Wenn das die Logik wäre, würde sich auch ein solcher Gedanke nicht in die gläubige katholische Tradition einfügen, denn menschliches Person-sein bedeutet in dieser großen Tradition hier immer die Einheit von Leib und Seele, die das Sein des ganzen Menschen ausmacht. Vielmehr wäre eine solche Deutung längst auf dem Pfad der Gnosis, dem die Kirche aber seit zweitausend Jahren widerspricht.
Keine Problematisierung der Transidentität
Was auch noch erschreckend ist: Gerade das Feld der Transidentität wird als ein selbstverständlich unter jungen Menschen auftauchendes Phänomen benannt, als eine unter vielen möglichen Weisen seine Identität zu entdecken. Soweit ich sehe, wird es an keiner Stelle problematisiert, vielmehr scheint der Text durchgehend einen affirmativen Grundton im Blick auf trans Jugendliche anzuschlagen, um eben das Ziel einer gesunden Identitätsfindung im Werden einer Persönlichkeit zu erreichen – in diesem Fall einer Transpersönlichkeit. Dabei ist in jüngerer Zeit gerade dieses Phänomen vielfach aufgegriffen und in Medien, politischen Auseinandersetzungen im In- und Ausland, in populärer Literatur, in Fachliteratur und in zahllosen Netzforen massiv problematisiert worden. Es gibt im Text beispielsweise keine Warnung davor, zu schnell die Entwicklung hin zu einer jugendlichen Transidentität affirmativ zu unterstützen. Und das, obwohl sich in einigen anderen Ländern um uns der Wind längst gedreht hat – und geschlechtsangleichende Operationen oder Hormontherapien bei Jugendlichen angesichts der Folgeprobleme wieder massiv eingeschränkt oder verboten worden sind, z. B. in Großbritannien, Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark. Dies sind aber besonders jene Länder, die in diesem Feld zunächst progressiv vorangegangen waren. Sollte also mit diesem „Bischofspapier“ beabsichtigt worden sein, auf der Höhe der Zeit im gesellschaftspolitischen Diskurs zu sein, dann ist der Text vor allem in diesem Punkt bereits deutlich veraltet. Leider ist aber gerade das ein Punkt, eine Thematik, bei der vulnerable Jugendliche besonders schutzbedürftig wären und besonders sensibler Begleitung bedürften.
Waren oder sind wir gut im Umgang mit der Thematik bei Jugendlichen? Nein!
Dann noch einige persönliche Anmerkungen: In einer ersten Lektüre des ersten Textentwurfs konnte und wollte ich in einer Hermeneutik des Wohlwollens das ehrliche Bemühen erkennen, jungen Menschen auf dem gerade heute so herausfordernden Weg der Suche nach ihrem eigenen Selbststand behilflich zu sein. Hier verdient jeder Schüler, jede Schülerin tatsächlich sensible, aufmerksame Begleitung. Und er verdient, dass die Schule sich bemüht, ein Ort zu sein, an dem auch seine Fragen, Sehnsüchte und Probleme zur Sprache kommen können, in einer Atmosphäre des grundsätzlichen Wohlwollens und Respekts vor ausnahmslos jedem Menschen. Und wenn wir uns als Menschen der Kirche ehrlich fragen, ob wir in früheren Zeiten gut darin waren, uns selbst solchen Fragen zu stellen oder ob wir gut darin waren, Menschen zu begleiten, die außerhalb dessen leben, was wir als das „Richtige“ erkannt zu haben meinen, dann müssen wir ehrlich sagen: Wir haben oft genug genau darin versagt. Das heißt, in unserer theologischen und pädagogischen Kompetenz, in der es auch um sexualethische Fragen bei Jugendlichen geht, haben wir tatsächlich intensiven Nachholbedarf. Wie auch in der Frage: Wie sind wir grundsätzlich und in einem guten Sinn mit allen Menschen gemeinsam Kirche, auch dann, wenn Menschen sich für einen anderen Lebensstil entscheiden, als ihn der Glaube und seine Moral vorschlagen?
Der Nachholbedarf in diesen Feldern kann aber nicht darin bestehen, dass wir auf unsere eigenen, sehr grundsätzlichen Positionen zum Menschenbild verzichten. Vielmehr sind wir im Glauben herausgefordert, das uns eigene so einzubringen, dass es ein ehrliches Angebot sein kann, Menschen in eine tiefere Freiheit, Sinnerfüllung, Liebesfähigkeit und Ganzheit zu führen. Und zwar als ein Angebot, das von der Tiefe und Schönheit seines Gehalts nirgendwo sonst auf der Welt zu bekommen wäre. Im vorliegenden Text scheinen wir junge Menschen genau von diesem Angebot ausdrücklich verschonen zu wollen.
„Mit Christus kommt immer wieder die Freude“
Selbstverständlich wird ein solcher Weg in die größere Ganzheit mit Christus in dieser Weltzeit nie zu einer Vollendung kommen. Zu sehr spüren wir allein durch die Sterblichkeit unseres biologischen Lebens bleibende Kräfte der Desintegration. Aber Paulus spricht auch davon, dass wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird – sich der innere Mensch dennoch Tag für Tag erneuert (vgl. 2 Kor 4,16). Es ist also möglich, gerade auch unter den Bedingungen der Sterblichkeit und des Kreuztragens immer noch ein reiferer, heilerer Mensch in diesem Sinn zu werden. Und angesichts unserer biologischen Sterblichkeit und Schwäche bin ich auch nicht so naiv zu glauben, dass das Hineinfinden eines Menschen in ein gläubiges Leben sogleich alle Fragen seiner Identitätssuche oder sexuellen Orientierung beantworten würde. Aber was ich aus Erfahrung mit vielen Menschen sagen kann: In mehr inneren Frieden und in tiefere Integration in der eigenen Selbstwerdung kann und wird ein Leben mit Christus immer führen. Oder wie Papst Franziskus es sagte: „Mit Jesus Christus kommt immer – und immer wieder – die Freude.“ (Evangelii Gaudium, 1)
Im Grunde dreht der vorliegende Text – unter dem Schein des Glaubens oder des „christlichen Ethos“ diese Perspektive genau um. Er verwendet innerweltlich aufgefundene menschliche Zustände, lädt sie normativ auf – als von Gott geliebte und gewollte Vielfalt, die zugleich „Identitäten“ sind – und versucht dann die Glaubensperspektive so weit wie möglich draußen zu halten – vor allem, wenn sie mit einem vermeintlich veralteten Wahrheitsanspruch daherkommt. Oder er verkürzt die Glaubensperspektive derart, dass sie in ein neues, vor allem ideologisch geprägtes Menschenbild hineinpasst: Menschwerdung heißt dann, die eigene queere Identität finden und die Offenbarung so deuten dürfen, dass sie mich darin vor allem bestätigt.
Eine genuin christliche Deutung der Phänomene würde aber genau andersherum argumentieren: Die Offenbarung erzählt uns vom gelingenden Menschsein und der Neuwerdung des Menschen in Christus – und wir fragen uns, welche Antwort auf die heutigen Fragen der Selbstwerdung des Menschen daraus gegeben werden kann. Hieße das dann aber, dass wir von der Welt und den Menschen in ihrem Sosein und von den Humanwissenschaften nichts mehr lernen könnten? Nein, keineswegs. Denn die Probleme sind groß und tief – und jedes tiefe Problem, das wir ins ehrliche Gespräch mit dem Glauben bringen, ist geeignet, uns auch den Glauben und uns selbst tiefer verstehen zu lassen.
Außerdem: Nach einer ersten Lektüre des Textentwurfs hatte ich versucht, als einen ergänzenden Modus die Position zum Thema „christliche Identität“ einzubringen, die ich oben in den ersten drei Abschnitten entfaltet habe. Die Antwort war im Wesentlichen ablehnend. Ich habe dann noch einmal mit Nachdruck eingebracht, dass wir doch nicht einfach das preisgeben dürften, was uns in solch wesentlichen Fragen das Wichtigste sei. Das Ergebnis dieses Nachfassens war, dass nun im Geleitwort zum Text (und nicht im Text selbst) ein paar Zeilen über die „Freundschaft mit Christus“ stehen, die dort aber wiederum anders ausgelegt werden, als ich sie versucht hatte im Blick auf die Grundproblematik darzustellen.
Der Hintergrund: Das grundsätzliche Ringen um die Anthropologie
Dieses Hin und Her und der ganze Text machen final ein gewaltiges Hintergrundproblem deutlich, das nach meiner Ansicht auch das Grundproblem in der Auseinandersetzung um die Themen des Synodalen Weges ist – auch unter uns Bischöfen. Ich bin der Überzeugung, dass wir vor allem im Westen in einer Zeit leben, in der sich die entscheidenden Debatten und Auseinandersetzungen um die Anthropologie, um die Lehre vom Menschen, drehen. Für uns als Katholische Kirche geht es dabei um das Verständnis des Menschen als einem sakramentalen Wesen, das heißt als eine endliche Wirklichkeit, in der und durch die sich der unendliche Gott als real präsent offenbaren kann. Im Grunde kann man in einem abgeleiteten Sinn des Begriffes „Sakrament“ sagen: Die Berufung des Menschen ist es, Sakrament zu sein und immer mehr zu werden. Sexualethische Fragen und Fragen der Identität gehören mitten in diese umkämpfte Debatte hinein, weil sie so grundlegend unser Selbstverständnis, unser Leibverständnis und unsere Weltauffassung berühren. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es in dieser Debatte auch prinzipielle Grenzen gibt, die nicht einfach graduell verschiebbar sind. Die weite Mehrheit – auch in der Kirche in unserem Land – denkt diese Fragen dagegen wohl eher in einem Entwicklungsparadigma. Das heißt, bei den meisten herrscht etwa folgende Überzeugung vor: „Irgendwann wird es auch in der Katholischen Kirche so weit sein, dass z. B. Frauen die Priesterweihe empfangen oder Paare außerhalb einer Ehe von Mann und Frau auch liturgisch gesegnet werden können. Noch sind wir eben noch nicht so weit.“ Irgendwann, so folgern die meisten dann auch, würden diese Grenzen ohnehin überschritten – und genau deshalb könne man diese Überschreitung auch jetzt schon für wahr halten und als Wahrheit ausgeben.
Ich halte diese Grenzen dagegen für prinzipiell gegeben[6] und nicht für graduell allmählich verschiebbar. Ihre Überschreitung würde nach meiner Überzeugung am Ende zu einer anderen Kirche führen. Denn eine andere Lehre vom Menschen führt zu einer anderen Lehre von der Offenbarung, von den Sakramenten, von der Erlösung – und damit notwendig zu einer anderen Lehre von der Kirche und ihrer Existenz – im letzten sogar zu einem anderen Verständnis vom dreifaltigen Gott. Papst Franziskus hatte mehrmals in Richtung von uns Deutschen im Blick auf den Synodalen Weg etwas lapidar gewarnt: „Es gibt schon eine evangelische Kirche in Deutschland, es braucht nicht noch eine“. Weil uns als Glaubensgemeinschaften gerade das Verständnis von Sakramentalität im Kern unterscheidet, hat Franziskus hier einen wichtigen Punkt gesehen: Die Auffassung von Mensch und Kirche als Sakrament steht in dieser Debatte zur Disposition. Und der hier verhandelte Text der Schulkommission der Bischofskonferenz ist in der vorliegenden Fassung auf dem besten Weg zu einem entsakramentalisierten Verständnis des Menschen.
Daher möchte ich zunächst die dem Text spürbar zugrunde liegende Sorge um die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen und auch von Menschen, die sich als queer identifizieren, in der Schule ausdrücklich bejahen und würdigen. Aber von seinen inhaltlichen Voraussetzungen und seinem theologischen, philosophischen, pädagogischen und entwicklungspsychologischen Gehalt möchte ich mich in aller Form distanzieren. Wenn auch auf dem Umschlag der Broschüre steht: „Die deutschen Bischöfe“, dann spricht der Text trotzdem nicht in meinem Namen.
Bischof Stefan Oster SDB, Passau
Ein Nachtrag (28.11.2025):
Verschiedentlich ist in Reaktionen auf diesen Text angemahnt worden, ich würde darin nicht eingehen auf das konkrete Problem des praktischen Umgangs im Schulalltag mit Jugendlichen, die sich als queer verstehen. Ich kann das nachvollziehen. Aber das war im obigen Text nicht meine Absicht. Mir ging es um die sehr grundsätzliche Frage, warum eben das Menschenbild, das uns als Christen gegeben ist, nicht mehr als Ressource gesehen wird, die einen wichtigen Beitrag leisten könnte, im Umgang mit den tiefgreifenden und komplexen Fragen in diesem Feld. Vielmehr erweckt der ganze Text der Schulkommission den Eindruck, dass diese Ressource entweder gar nicht mehr im Blick ist, oder aber als überholt oder gar als schädlich überwunden werden muß. Daher der sehr grundsätzliche biblisch-anthropologische Ansatz und die daraus folgende Kritik meinerseits.
Was aber das berechtigte Anliegen angeht, wie denn nun damit konkret in der Schule umzugehen ist, dazu bin ich auf ein knappes aber hilfreiches Büchlein hingewiesen worden, das freilich nicht explizit die biblisch-christliche Position aufgreift, aber immerhin eine differenzierte, hilfreiche und sehr praxisorientierte Perspektive aus „personalistischer Pädagogik“ versucht. Denn der „Personalismus“ als eine Denkströmung v.a. des 20. Jahrhunderts ist insbesondere aus dem religiösen, jüdischen und christlichen Denken erwachsen. Hier also der Buchtip: Maria Witzler, Trans* in der Schule. Eine Hilfestellung für Pädagogen. Herausgegeben vom „parteipolitisch und konfessionell unabhängig(en)“ (Selbstbeschreibung) Elternverein NRW e.V. ISBN-13: 9783759792815 (z.B. hier: https://buchshop.bod.de/trans-in-der-schule-9783759792815)
Außerdem zu empfehlen: Ein hilfreiches Papier der australischen Bischofskonferenz, das allerdings wohl primär für katholische Schulen gedacht ist und nicht als Ratgeber für jede Schule und Schulart: „Created and Loved. A guide for Catholic schools on identity and gender“. Hilfreich sind die dortigen Ausführungen allemal. Hier auch zum kostenlosen Download: https://drive.google.com/file/d/1X11WeuMYfHeyMwVmMQMivzMZUnI6rOQQ/view Wichtige Ausschnitte aus diesem Dokument sind auch schon ins Deutsche übersetzt in der Zeitschrift „Der Ruf des Königs“ Ausgabe 2024/3 und 2024/4: Hier der Link dazu: Created and Loved deutsch
[1] Die deutschen Bischöfe. Kommission für Erziehung und Schule, Nr. 58. Geschaffen, erlöst und geliebt. Sichtbarkeit und Anerkennung der Vielfalt sexueller Identitäten in der Schule. Bonn, 1. Oktober 2025. Einsehbar und zum Download hier: https://www.dbk-shop.de/media/files_public/166bf6581adb9d49f8f6460292162a6f/DBK_1258.pdf
[2] II. Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution „Lumen Gentium“, 11
[3] In De Div Nom 4, 12: „intelligimus per nomen amoris quamdam virtutem unitivam et concretivam“.
[4] Vgl. ebd. S. 8, Fußnote 3
[5] Die jüngsten lehramtlichen Äußerungen zum Thema: Vgl. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240402_dignitas-infinita_ge.html, hier besonders Abschnitte 55-60.
[6] Warum ich sie für prinzipiell halte, habe ich an anderen Stellen z.T. ausführlich dargestellt, etwa hier
https://stefan-oster.de/der-synodale-weg-v-die-absichtslose-liebe-und-die-frage-nach-dem-priestertum-der-frau/ oder hier: https://stefan-oster.de/der-synodale-weg-iv-die-absichtslose-liebe-und-unsere-sexualitaet/

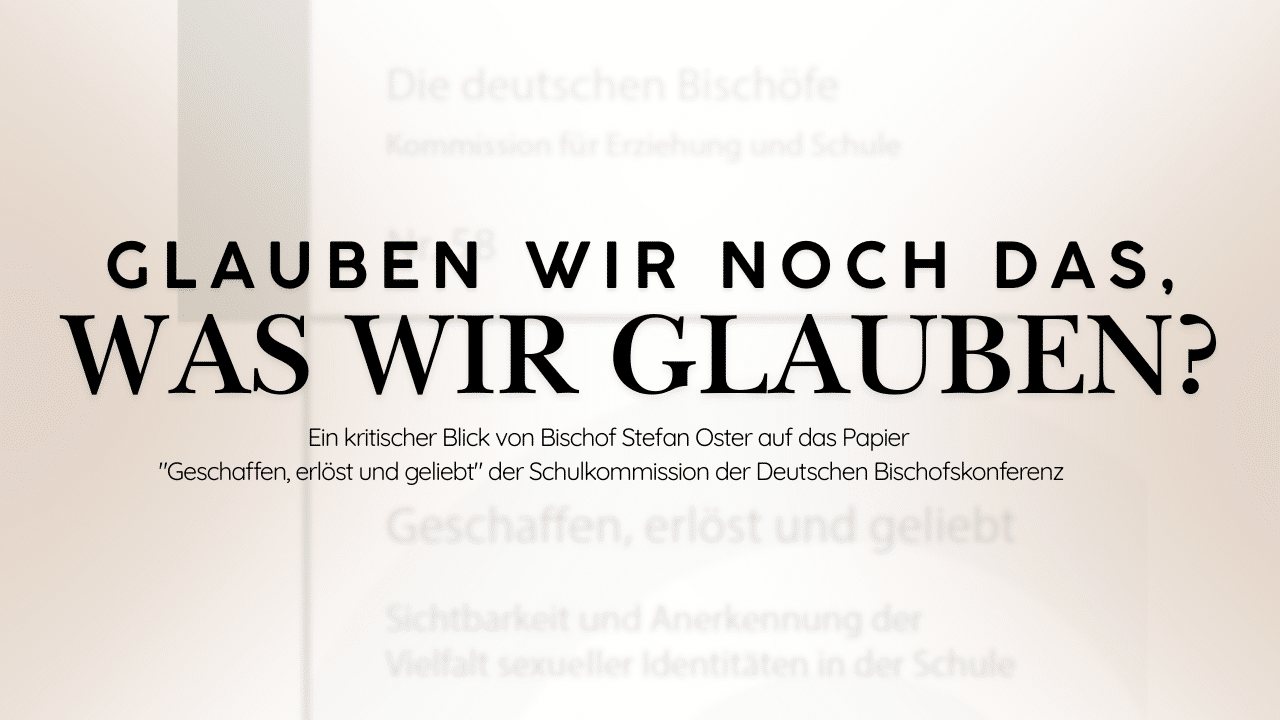
Comments
Lieber Bischof Stefan, ich danke Ihnen sehr für diese umfassende Ausführung und die klare Stellungnahme. Warum ihre Brüder sich nicht äußern, bleibt mir völlig unklar.
Danke, dass Sie sich immer wieder in den Wind stellen, das ermutigt uns Gläubige sehr auch weiterhin Christus und unsere Lehre im alltäglichen Kontext zu verteidigen! Erst gestern wieder vor vier ausgetretenen frustrierten Katholiken passiert. Was soll man da zur Verteidigung der Bischöfe vorbringen, wenn sich nicht mal diese auf so ein absonderliches Papier äußern, oder es sogar noch freigeben?
Wir bleiben Christus treu, weil er den Weg bereits gegangen ist und gesiegt hat! Halleluja!
Lieber Bischof Oster,
an erster Stelle möchte ich Ihnen für Ihren mutigen Einsatz für das Lehramt der Kirche danken. Es bedarf nicht wenig Kraft und Rückgrat sich auf diese Weise von einem solchen Schreiben der deutschen Bischöfe zu distanzieren. Zugleich bewundere ich Ihr Wohlwollen und Ihre Geduld gegenüber Ihren Mitbrüdern im Bischofsamt.
Ich stehe am Ende meines Lehramtstudiums für Katholische Religionslehre für Gymnasium und vor dem Antritt meines Schuldienstes, weshalb mich das Schreiben wohl mehr als andere persönlich betrifft. Auch ohne dieses Schreiben mache ich mir im Hinblick auf meinen Glauben, meine Werte und die Herausforderungen im Schulalltag Sorgen. Ich kann es also nicht anders sagen, als dass mich dieses Schreiben sprachlos lässt. Ich kann nicht sagen, ob es die Absicht der Bischöfe war, uns katholischen Religionslehrern den Rücken zu stärken und uns konkrete und ermutigende Handlungsanweisungen für unsere Arbeit zu geben, aber ich muss sagen, dass ich mich hier nicht unterstützt, sondern alleingelassen sehe. Ja, es mangelt nicht nur an didaktischen und pädagogischen Herangehensweisen an die Vermittlung und Thematisierung der katholischen (!) Sexuallehre, sie sind schlichtweg nicht vorhanden. Dass nun aber auf diese Weise von Seiten der Bischöfe ein Angriff auf die Grundprinzipien der katholischen Sexualmoral und des christlichen Anthropologie gefahren wird, ist mir unbegreiflich. Ich hätte mir so sehr gewünscht und es wäre so dringend notwendig gewesen, die Lehrkräfte, die gewillt sind die so dringend benötige Bildung und Erziehung der nächsten Generationen zu gewährleisten, an die Hand zu nehmen, zu ermutigen und aufzuzeigen, wie sie sich in dieser so schwierigen Zeit und unter den vielseitigen Anfeindungen gegen die Kirche verhalten können. Stattdessen werden wir aufgerufen, uns den Ideologien dieser Zeit widerstandlos zu ergeben und zu obendrein die Sexuallehre der Kirche nicht kritisch zu diskutieren, sondern sie scheinbar lediglich zu kritisieren.
Ich möchte Ihnen, Bischof Oster, danken, dass Sie durch Ihre Worte so deutlich Position beziehen und mir damit zeigen, mit meinen theologischen und praktischen Bedenken und Fragen nicht allein zu sein.
Ich möchte Sie bitten, nicht nachzulassen, sich unter Ihren Mitbrüdern und in der deutschen Kirche Gehör zu verschaffen. Seien Sie sich der Unterstützung und dem Gebet vieler gleichgesinnter Katholiken versichert!
Gottes Segen Ihnen!
Mit besten Grüßen
Leonhard Wiesböck
Ein grundlegender Beitrag von Bischof Stefan Oster zum Thema. Unabhängig von ihm habe ich vor einiger Zeit im Kern den gleichen Gedanken in einer Festschrift für einen US-amerikanischen Kollegen entfaltet: Der christliche Glaube beruht auf einer (spirituellen) Praxis, die zu einer tiefgreifenden Transformation der Identität führt. Wer, wie das von Bischof Oster zu recht kritisierte Dokument davon ausgeht, dass ein Mensch von Natur aus eine bestimmte Identät hat, an der nichts mehr zu ändern ist, hat sich eigentlich vom Anspruch des christlichen Glaubens verabschiedet. Ohne eine „zweite Geburt“, eine „Geburt von oben“ (Joh 3,3.5.7), eine „Geburt aus Gott“ (1,3), eine „Geburt aus dem Geist“ (Joh 3,5) findet niemand in das Reich Gottes. Der Evangelist stellt das gleich zu Beginn seines Evangeliums klar. Der Gedanke findet sich vor allem auch bei Paulus, prägt aber – in unterschiedlicher Terminologie – die gesamte Heilige Schrift. Dies scheint bis tief in kirchliche Leitungskreise hinein nicht mehr bekannt zu sein. Am ehesten findet man ihn noch bei einigen sogenannten Mystikern, z. B. sehr deutlich bei Thomas Merton; aber auch bei anderen. Die Frage ist für mich: Wie kann das geschehen? Welche Hilfen bietet die Kirche an – ganz abgesehen davon, dass dieser Gedanke erst einmal wieder ins Bewusstsein der „kirchlichen Öffentlichkeit“ gelangen muss. – Bischof Oster verweist vor allem auf die Eucharistie und die Sakramente. Hier wäre meine Frage, ob die verbreitete Praxis des Empfangs der Sakramente ausreicht, um jenen Prozess in Gang zu setzen, von dem Bischof Oster spricht und der zum Kern des christlichen Glaubens gehört. Zwar wirken die Sakramente aus sich heraus, doch wenn in der Breite des kirchlichen Volkes gar nicht mehr bekannt ist und kaum Hilfen angeboten werden, wie man sich für den Empfang der Sakrmente disponieren kann und soll, dann wird es schwierig. Andererseits gibt es viele gute Ansätze, bei denen die Feier der Sakramente zu einer echten Begegnung mit dem Mysterium der heilenden und erlösenden Gegenwart Gottes führt. In diese Richtung sollten wir in der Kirche weitergehen. Fazit: Ein grundlegender Beitrag von Bischof Stefan Oster, mit dem sich vor allem diejenigen Bischöfe, die das anders sehen, einmal gründlich befassen sollten. Meiner Einschätzung nach lässt sich zwischen den beiden Modellen kein Kompromiss finden; es handelt sich – von einigen wenigen Aspekten abgesehen – um zwei nicht miteinander zu vermittelnde Deutungen des christlichen Glaubens. Zu fragen wäre, wo die tieferen Ursachen dieser Fehlentwicklung liegen; dazu müsste man tief in die Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte einsteigen …
Lieber Bischof Oster,
herzlichen Dank für diesen Text. Ihre Worte schenken mir in diesen unruhigen Zeiten echte Hoffnung. Ich erlebe oft, wie die vielen modernen, sehr verkopften Deutungen des Glaubens Menschen eher verunsichern als stärken. Mein ehemaliger Religionslehrer, Pastor Sondermann, sprach immer vom Unterschied zwischen einem reflektierten Glauben und dem „Abrahamsglauben“. Heute habe ich manchmal den Eindruck, dass das ständige Verkomplizieren, Neu-Deuten und Hinterfragen mehr Verwirrung stiftet als Orientierung.
Ich habe das große Glück, eine tragende geistliche Gemeinschaft zu kennen, unter anderem mit Ordenspriestern des Instituto Verbo Incarnato. Sie geben mir Kraft und Orientierung. Doch selbst dort spüren wir, wie sehr die Unruhe wächst, weil so viele Stimmen ihre eigene „Version“ der Wahrheit anbieten. Manche Diskussionen, die auf katholischen Seiten geführt werden, wirken auf mich, als würden sie Menschen eher in einen Nebel aus Möglichkeiten führen, statt ihnen Halt im Evangelium zu geben. Und ich kann an keiner Stelle der Schrift erkennen, dass Christus wollte, dass wir den Glauben zu einem Baukasten aus immer neuen Anpassungen machen.
Gerade deshalb bin ich Ihnen dankbar. Ihre Texte sind für mich ein Anker. Sie sprechen klar, ohne Härte, und erinnern daran, dass die Aufgabe der Kirche darin besteht, das weiterzugeben, was Jesus uns gelehrt hat.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Mut für Ihren Weg. Ich kann nur ahnen, wie viel Gegenwind Sie in Ihrer Position spüren.
Danke, dass Sie dennoch so standhaft bleiben. Sie geben vielen Menschen wie mir Halt.
Mit herzlichen Grüßen
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Andreas-Claudius Hoffmann
Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie
Psychoonkologe [DKG]
„Alles vermag ich durch den, der mich stärkt.“ (Phil 4,13)
„Die Schule ist ein sozialer Ort“ heißt es in der Einleitung. Mehr Sozialethik kommt im Text nicht zur Sprache. Robert Spaemann hat einmal gesagt „Person gibt es nur im Plural.“
Wenn die Formung sexueller Identität dazu führt, dass ein Schüler sich als ‚anders‘ erlebt, ergeben sich individualethisch Herausforderungen.
Sozialethisch bleibt jedoch wichtig, dass die Schüler alle gleich sind in der Gemeinschaft. Das Schulleben und die Schulkultur werden geprägt durch diese Gemeinsamkeit, die heilend wirkt.
In diesem Rahmen müssen auch Maßnahmen wie ein „Coming Out“ gesehen werden: Dass es queere Menschen in der Schule gibt, sollte bekannt sein, im Übrigen muss kein größeres Aufheben gemacht werden.
Die Sozialethik ist in bestimmter Hinsicht vorrangig zu individualethischen Betreuungskonzepten.
Der Text der Kommission erscheint als Beschreibung der Lage der Queer eindrücklich, bräuchte dann aber einen eigentlichen sozialethischen Teil:
Gesellschaft ist nicht einfach eine Angelegenheit, in der Menschen zusammenfinden, die alle so unheimlich verschieden sind – im Gegenteil.
Das Erleben der Gemeinschaft aller Gläubigen ist zentral in der Kirche Afrikas wenn nicht gar in der Weltkirche.
Andreas Peltzer
Diplomtheologe
Okahandja / Namibia
Sehr geehrter Herr Bischof Oster,
ein sehr herzliches Vergelt’s Gott für Ihre Stellungnahme. Sie distanzieren sich mutig von dem „DBK-Papier zur sexuellen Vielfalt“, das dem Anschein nach „die deutschen Bischöfe“ tragen. Hier stellt sich mir mal wieder die Frage: „mit welchem Recht heisst es – die deutschen Bischöfe“? Das erinnert mich an die verschiedenen Schreiben, die ich an das ZdK und auch an Frau Stetter-Karp persönlich geschrieben hatte, zum Teil per Einschreiben. In diesen Schreiben habe ich wiederholt nachgefragt, wer das ZdK legitimiert hat zu sagen „wir deutschen Katholiken fordern“. Leider habe ich weder vom ZdK, noch von Frau Stetter-Karp hierzu jemals eine Antwort erhalten.
Was mich sehr traurig und bestürzt macht, ist die Tatsache, dass – vor allem in Deutschland – immer gefordert wird. Dabei stelle ich mir dann die Frage: „was wäre geschehen, wenn Maria nicht gesagt hätte „siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe wie du gesagt hast“, sondern ihre Antwort hätte vielleicht gelautet „ja gut, dann mach‘ ich das aber im Gegenzug fordere ich……“ Beim WJT 2019 in Panama war das Thema eben dieses „JA“ von Maria und ich hatte das Glück, bei diesem WJT die jungen Menschen aus verschiedensten Ländern und Kulturen zu erleben, wie sie gemeinsam gebetet, gesungen, geschwiegen, getanzt haben und eben keine Forderungen gestellt haben.
Anfang Januar 2025 habe ich dann einen Brief an Weihbischof Hieronymus Messing vom Bistum Essen „der Queer-Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz“ geschrieben. In diesem Schreiben habe die Frage gestellt „sind wir nicht ALLE Menschen“? So ist es in unserem Grundgesetz verankert und meiner Meinung nach müssen hier keine einzelnen Gruppierungen aufgezählt werden, denn wir sind ALLE Menschen! Hier muss ich noch erwähnen, dass ich von Herrn Messing ein Antwortschreiben erhalten habe – aus meiner Sicht jedoch nicht aussagekräftig.
Zum Schluss möchte ich mich nochmals bei Ihnen für diese Stellungnahme bedanken!
Gesegnete Grüße aus dem Schwarzwald und im Gebet verbunden
Doris Hilberer
Hochwürdigster Herr Bischof Oster,
von Herzen danken wir Ihnen für Ihre klare Stellungnahme zum Schreiben der Schulkommission der Deutschen Bischofskonferenz „Geschaffen, erlöst und geliebt“.
Es ist ein kleiner Trost, dass wenigstens einer unserer deutschen Bischöfe die katholische Lehre vertritt, sich dazu bekennt, und offen gegen dieses Papier protestiert.
Wir, die Laien, benötigen dringend wieder Hirten, die uns die Wahrheit verkünden, den wahren Glauben lehren und uns in dieser verwirrten Zeit führen und stärken.
Wie soll und kann der christlich-katholische Glaube in den Herzen der Menschen fruchtbar werden und wachsen, wenn er nicht mehr gelehrt wird? Wie sollen unsere Kinder gläubig, rein und keusch nach den Zehn Geboten Gottes erzogen werden, wenn sie unsere katholischen Schulen besuchen, dort aber das Gegenteil gelehrt bekommen – mit Genehmigung und Unterstützung der deutschen Bischöfe?
Wir verstehen unsere Kirche in Deutschland nicht mehr. Wir entwickeln uns zu einer „Herde ohne Hirten“.
Ihnen danken wir von Herzen, dass Sie trotz der sicher bevorstehenden Angriffe standhalten. Sie geben uns, und sicherlich vielen weiteren Gläubigen, Hoffnung und Kraft.
Hoffentlich werden weitere Bischöfe sich von dieser unguten, zur Verwirrung führenden und zur Sünde bejahenden Stellungnahme distanzieren.
In Liebe zu unserer Kirche, für alle Bischöfe betend und Ihnen im Gebet besonders verbunden,
Andrea und Frank Kremer
(Bodenseekreis)
Entsprechend seiner gewählten Überschrift „Glauben wir noch, was wir glauben“ gibt Bischof Oster eine knappe dogmatische Auskunft auf höchster Ebene über die Grundverfassung und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. So wahr diese Aussagen sind, sie gehen am Denken der Schulkommission völlig vorbei. Insofern kann die Antwort nur sein: Die allermeisten Menschen glauben nicht mehr, was der Glaube lehrt. Bischof Oster weist zu Recht eine von Geburt an „gesetzte“ diverse sexuelle Orientierung zurück. Er betont die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, aber was bedeutet sie? Es heißt, durch den Glauben an Jesus Christus und Befolgung seiner Gebote zum ewigen Leben zu gelangen und nicht auf ewig von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen zu bleiben. Es muß klar sein, der Weg der Diversität führt nicht zum ewigen Heil. Diese Tatsache darf in der Kirche nicht tabuisiert werden.
Bischof Oster hat es nicht gewagt, an die Schöpfungsordnung zu erinnern, nach der es nur zwei biologische Geschlechter gibt, und welche Einstellung eines Katholiken sich daraus für den Umgang mit solchen Schülern ergibt, die von der Norm abweichen.
Sehr geehrter Herr Bischof, liebe Mitlesenden!
Auch ich danke für diese wichtige Klarstellung. Der Text der Kommission Schule&Erziehung ist eine Zumutung, die für mich allerdings nicht überraschend kommt.
In meiner früheren Funktion als pädagogischer Referent eines Kath. Büros hatte ich einmal das Vergnügen, telefonisch mit dem damaligen DBK-Bereichsleiter Bildung&Erziehung die Frage der Vereinbarkeit queerer Lebensführung mit dem Verkündigungsauftrag eines Religionslehrers zu diskutieren. Im Hintergrund stand seinerzeit die Frage, ob der Lebenswandel noch relevant für die Erteilung der Missio Can. sein könne. Mein Argument, dass man nicht authentisch die Lehre der Kirche von der heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit bezeugen könne, wenn man selbst offen homosexuell oder queer oder transident lebe, ließ er nicht gelten. Das Thema sei wissenschaftlich und theologisch kontrovers und so müsse es auch im RU diskutiert werden. Auf meinen (zugegeben polemischen) Einwurf hin, ob er (als Vertreter der Schulkommission) kein Problem damit habe, wenn ein Religionslehrer öffentlich nackt auf einer CSD-Parade tanzen würde, hat er das Gespräch beendet.
Warum ich das erzähle? Nun, es ist davon auszugehen, dass auch der hier besprochene Text aus der Feder genau jenes Menschen (und/oder Gleichgesinnter) stammen dürfte. Wo war die kritische Gegenlektüre etwa durch den Beraterstab der Kommission? Wo die Nachfragen der Bischöfe auf der fraglichen Kommissionssitzung?
Aber auch auf die Praxis der Entstehung solcher Texte wirft dies ein schlechtes Licht: Für eine Tätigkeit beim VDD braucht es kein Nihil obstat und keine Missio, hier können vermeintliche Theologen schreiben, was sie wollen, und die Ergebnisse werden solange auf die Tagesordnung gebracht, bis sie verabschiedet sind.
Ich für meine Stücke, lese die Veröffentlichungen der Schul- und der Pastoralkommission nicht mehr. Umso wohltuender habe ich Ihren Beitrag empfunden!
Dr. Markus Kremer, Bühl
Sehr geehrter Herr Bischof,
wenn ich ehrlich bin, überzeugen mich weder die Ausführungen der Schulkommission, noch Ihre Stellungnahme dazu. Das Dokument „geschaffen, erlöst und geliebt“ empfinde ich als zu einseitig und sowohl in der Praxis, als auch im Bezug auf die Lehre, zu wenig in die Tiefe gehend. Die Forderungen z.B. an die Lehrkräfte Vorurteilen, Mobbing und Diskriminierungen entgegenzuwirken und für Kinder ansprechbar zu sein, sind ja sowieso selbstverständlich und ganz bestimmt nichts Neues. Was ich aber als sehr positiv sehe, ist, dass die Verfasser den Blick auf die Kinder und Jugendlichen gerichtet haben. Das vermisse ich bei Ihrer Stellungnahme sehr. Natürlich haben Sie recht mit allem, was Sie über die christliche Identität schreiben. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie betonen, dass wir alle erlösungsbedürftig sind. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass es nicht gut ist, einfach nur so zu bleiben, wie wir sind. Natürlich weiß ich in größter Gewissheit, dass gerade Sie ein riesengroßes Herz für unsere jungen Leute haben! Trotzdem hätte ich mir einen anderen Aufbau Ihrer Stellungnahme gewünscht. Um was geht es denn hier? In erster Linie doch um Kinder und Jugendliche in der Schule, die gemobbt werden könnten oder bei denen die Gefahr besteht, diskriminiert zu werden. Es geht um Kinder und Jugendliche, die verunsichert sind, die Sorgen, Nöte, Zweifel und Kummer haben. Es geht um Schüler und Schülerinnen, die Unterstützung brauchen, die Sehnsucht nach Anerkennung haben und die Gespräche führen möchten ohne in die Gefahr zu kommen, verurteilt und somit erneut verletzt zu werden. Es geht um junge Leute, die hoffen, dass sie jemand versteht. Statt mit der Situation der Schüler und Schülerinnen zu beginnen, finde ich in Ihren Ausführungen erst irgendwann mal in der hinteren Hälfte den Blick auf die Kinder und Jugendlichen und das nur in wenigen Sätzen. Herzliche, achtsame Worte wären zu Beginn notwendig und würden so viel mehr aus Ihren Ausführungen machen. Im konkreten Schulalltag müssen wir zuerst bei den jungen Leuten sein und dann erst wird es möglich, das dazuzulegen, was Sie ausführen. Anders wird es nicht funktionieren.
Wenn ich Sätze lese, wie „Der Text spricht nicht in meinem Namen“ oder „Ich habe nicht den Eindruck, dass aufeinander gehört und dass gemeinsam um das, was uns aufgetragen ist, gerungen wird, sondern es wird eine politische Agenda durchgezogen auf Teufel komm raus.“ (Bischof Voderholzer), dann tun sich wieder einmal ganz deutlich – wie so oft – Gräben auf. Deshalb mein Wunsch (wobei ich skeptisch bin, dass er in Erfüllung gehen wird): Gehen Sie aufeinander zu! Setzen Sie sich zusammen! Lassen Sie die gegensätzlichen Postionen nicht einfach nur unversöhnt stehen – damit ist niemandem geholfen. Seien Sie synodal, im hörenden Sinn unterwegs und erarbeiten Sie gemeinsam ein Papier, in dem einerseits die Schüler und Schülerinnen im Blick sind und bei dem andererseits aber auch die tiefen Erkenntnisse der christlichen Identität nicht zu kurz kommen. In allererster Linie zum Wohle unserer, uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und dann vielleicht auch ein klein wenig als eine Hilfe für mich als Lehrerin.
Liebe Frau Ammerl,
ich kann Ihre Kritik (im Sinn von: ein weiterer Beitrag zur Polarisierung, der aber nicht synodal ist) nachvollziehen, kann mich aber hier nicht näher dazu äußeren. Sie müssten dazu die Hintergründe der Entstehungsgeschichte des Textes der Schulkommission kennen – und meine und andere Bemühungen, sich da inhaltlich deutlicher einzubringen. Das gehört aber nicht an die Öffentlichkeit.
Zweitens: Ich habe oben einen kurzen Nachtrag zum Text formuliert, der das Grundanliegen meiner Ausführungen noch einmal knapp darlegt – und der dann auch das Anliegen von Ihnen (und anderen) aufgreift, stärker praxisorientierte Positionen für den Schulalltag dazuzulegen durch den Hinweis auf zwei Veröffentlichungen. Sicher gäbe es dazu noch mehr.
Gruß SO
Sehr geehrter Herr Bischof,
vielen Dank für Ihre klaren Worte und dafür, dass Sie Ihre Brüder im Glauben stärken.
Ihr Text ist nun auch in kroatischer Übersetzung verfügbar: https://www.vjeraidjela.com/vjerujemo-li-jos-uvijek-ono-sto-vjerujemo/
Herzliche Grüße aus Dubrovnik,
Petar Marija Radelj